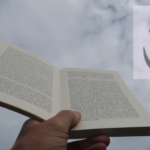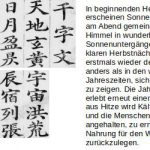Zwischen Kognition, Homöostase, Priorisierungen und Strategie

Der Versuch einer einfachen Beschreibung des Bewusstseins
Einleitung
Über die Entwicklung und Wirklichkeit des Phänomens Bewusstsein gibt es unzählige Theorien und Geschichten, die sich in Bezug zu Inhalt und Zielsetzung fast alle in entscheidender Weise unterscheiden. Sucht man nach einer Definition des Begriffes, zum Beispiel bei Wikipedia, bekommt man schnell eine sehr lange Latte an Beispielen.
Das Inhaltsverzeichnis dazu sieht ungefähr wie nachfolgend aus:
Bewusstsein in der Philosophie: Bewusstsein als Rätsel, Das Qualiaproblem, Das Intentionalitätsproblem, Innenperspektive und Außenperspektive, Bewusstsein, Materialismus und Dualismus
Bewusstsein in den Naturwissenschaften: Neurowissenschaften, Psychologie, Kognitionswissenschaft
Selbstbewusstsein: Selbstbewusstsein als Bewusstsein vom Selbst, Philosophie, Psychologie, Selbstbewusstsein als Bewusstsein von mentalen Zuständen
Bewusstsein bei Tieren: keine Erkenntnisse
Bewusstsein in den Religionen: Abrahamitische Religionen, Hinduismus und Buddhismus
Nun ist eine solche Breite in der Definitionsfrage dieses Begriffes genau die Grundlage, die dazu einlädt, diesen Begriff als „undefinierbar“ zu bezeichnen. Wenn jeder Wissenschaftszweig, jede Religion und jede Sprache eine andere Definition zugrunde legt, ist sozusagen das Chaos schnell perfekt.
Erster Versuch einer Definition von Bewusstsein
Beginnen wir als bei dem uns zugänglichen einfachsten Lebewesen, den Einzellern. Nach Damasio [1. Wie wir denken, wie wir fühlen, S.14, Antonio Damasio, Hanser-Verlag.] sind sie intelligent auf eine bemerkenswerte Weise. Sie nutzen aber weder Geist noch Bewusstsein, sondern eine Art von Kognition, die es ihnen ermöglicht, mit ihrer Umwelt zurecht zu kommen und über ihr Leben und dessen Fortbestehen zu bestimmen. Damasio nennt dieses „nicht-explizite Fähigkeiten“, also eindeutig vorhandene Fähigkeiten, und bekennt im „nicht“, das sie einer mentalen Betrachtung, wie sie heute im wissenschaftlichen Denken üblich sein sollte, verborgen bleiben. Alle Lebewesen verfügen über diese Fähigkeiten. Sie sind die Grundlage für Leben. Diese sind auch beim Menschen vorhanden und zu erkennen, aber wohl mehr durch ihr Wirken als durch ihre beobachtbaren Aktivitäten. Neben diesen verwendet der Mensch weitere Fähigkeiten, die wir als Kreativität und Vernunft beschreiben könn(t)en. Diese erweisen sich deutlich besser erforschbar und sind daher, zumindest glauben das die damit beschäftigten Wissenschaften, auch explizit schon erforscht.
Spätestens mit der Entwicklung und Ausbildung eines Nervensystems beginnt der ein Prozess bei allen Lebewesen, den man gerne als „geisthaft“ beschreiben kann. Dieser stellt sich dar wie ein ständig aktualisierter Strom von Daten, die etwas über die direkte Umwelt (über die Sinnesorgane) als auch den Zustand des eigenen Organismus (über dem Körper eigene Detektionssysteme) aussagen. Dieser Strom steht mit den nicht-expliziten Fähigkeiten in einen beständigen Austausch und Abgleich und sichert auf diese Weise den Fortbestand des Lebewesens auf beeindruckende Weise. Ich werde diese Mischung aus expliziten Fähigkeiten und Sinnes-Daten erst einmal „Lebensstrom“ nennen.
Erst die darauf entwickelte Vergrößerung und Erweiterung der Nerven und Gehirn-Areale ermöglicht es, dem Lebensstrom Bilder zu entnehmen und abzuspeichern und erlaubt es dem Lebewesen, sich ihrer zu erinnern. Die sich daraus ergebende Fähigkeit, erinnernde Bilder mit dem laufenden Lebensstrom abzugleichen und daraus Nutzen zu ziehen, würde ich Geist nennen wollen. Zu finden ist dieser in allen komplexen Lebewesen, die über ein ausgebildetes Nervensystem verfügen und sich damit in ihrer Welt orientieren können/müssen. Mindestens das gesamt tierische Leben verfügt über Geist. Neuere Forschung, die auch Pflanzen und Insekten bzw. Insektenstaaten Geist zuschreiben, sind zwar spannend und interessant, bilden aber für diesen Artikel und seinem Thema wenig Nutzen.
Bewusstsein in dem gesuchten Sinn findet sich überwiegend erst in Säugetieren, zu denen auch der Mensch gehört. Vielleicht können wir das, was bisher von mir benannt wurde, als die archaische Lebenswelt bezeichnen, was aber nicht auf die Bedeutung altertümlich, vorzeitlich oder frühzeitlich, sondern auf eine prä-bewusste Kognition hindeutet. Mit dem Bewusstsein kommt eine ganz neue Weise der Orientierung eines Lebewesens in die Welt. Aus dem Bilderstrom des Geistes bilden sich verschiedene Eingrenzungen, Zusammenfassungen und Deutungen heraus, die zu perspektivischen Sichtweisen führen. Ganz herausragend in diesen Neuerungen ist die Perspektive, die den Lebewesen ein „Ich“ ermöglichen, das sich in einer Welt befindet und/oder von ihr umgeben ist. Das Wesen erkennt sich selbst (seinen Körper) letztlich als eine Einheit, die von anderen Einheiten oder Dingen umgeben ist. Dieses Ich-Erkennen ist in meiner Vorstellung die erste Form eines Bewusstseins. Weitere Perspektiven, die darauf nahezu automatisch folgen mussten, sind verbunden mit den Wesen, die neben und mit diesem Ich in der Welt sind. Wir können das die „Wir/Die“-Sichtweisen nennen. Alle Perspektiven haben die Neigung, die Welt aus einer bestimmten, zuvor festgelegten Eingrenzung zu betrachten. Dazu gehören auch die bekannten Grenzziehungen, die wir heute Freunde, Partner, Familien, Gruppen, Völker, Staaten, Ethnien und so weiter nennen, die dann alle entweder unter „Meine“ oder unter „Die Anderen“ fallen können.
Nahezu alle heute üblichen Beschreibungen über die Entwicklung von Geist, Vernunft, Verstand und Bewusstsein beschäftigen sich letztlich mit den Ausprägungen dieser perspektivischen Betrachtungsweisen. Gebser zum Beispiel betrachtet nach der archaischen Bedingung das magische, das mythische und das mentale Bewusstsein und vermutet, das unterschiedliche Raum und Zeit-Wahrnehmungen eine große Rolle spielen könnten und prognostiziert eine sich entwickelnde neue diaphane Ebene, die im Kommen sei. Andere Autoren arbeiten mit Entwicklungsstufen verschiedenster Nomenklatur und anderen Teilungen der Gesamtentwicklung in Abschnitte. Weitere andere verfolgen die Entwicklung des Bewusstseins an unseren Kindern. Ihnen allen aber, und das ist für mich der ganz mächtige Haken, ist gemeinsam, das sie sich alle auf Teile des Bewusstseinsstromes beschränken, mit anderen Worten auf die Perspektiven der Betrachtungen und vergessen dabei die drei anfangs genannten Phänomene, die ich die nicht-expliziten Fähigkeiten, den Lebensstrom und Geist genannt habe. Diese drei, die in nahezu allen Kulturen so massiv im Schatten der Perspektiven verschüttet wurden, aber hatten sich über Jahrmillionen bewährt und wären wohl auch heute noch in der Lage, auch ohne Bewusstsein, das (Über-)Leben zu meistern. Und ich denke, das diese einfachste Meisterung nicht einmal halb soviel unserer Lebensgrundlagen zerstören würde wie wir das heute mit unserem Bewusstsein und seinen Prägungen Tag für Tag tun.
Worauf will ich hinaus?
Wie wir oben gesehen haben, beruht unser Leben auf der organischen Basis des Körpers. Wir brauchen ihn, um zu leben, und wenn er stirbt, fällt auch der Geist, zumindest konnte man bisher keinen verstorbenen Geist auf unserer Welt nachweisen und in andere Welten können wir nicht vordringen. Es gibt darüber viele Theorien, große Geschichten, aber sehr sehr wenig gesicherte Substanz. Und auch die Verbindung von Lebensstrom zu Geist ist von großer Bedeutung. Das nämlich ist unsere Grundlage, unsere geistige Basis, unser Grund, der nach wie vor relativ sich gestaltet, unter den wir aber nicht werden vordringen können. Aus dem Zusammenspiel der drei bilden sich Perspektiven, die somit alle auf Auswahl und Eingrenzung beruhen. Das ist auch sinnvoll. Aber bald schon in der Ausbildung des Bewusstseins wurden diese wenigen ausgewählten Perspektiven zu einer neuen Basis, auf der weitere Perspektiven entstanden sind. Und diese wurden wiederum zur Basis von neuen Perspektiven, die weitere Perspektiven erschufen, und so weiter und so weiter. Und auf jeder dieser neuen Ebenen sieht der jeweilige Denker nur noch die ihm bekannte und zugrunde gelegten Perspektiv-Ebenen und vergisst dabei sowohl die vorausgegangenen anderen Setzungen als auch den Grund darunter. Aber diese Ebenen sind da und sie sind nach wie vor wirksam.
Die Begrifflichkeiten von Jean Gebser
Magisch: Nehmen wir uns jetzt einmal eine solche Perspektiv-Ebene vor und erkunden ihre Auswirkungen. Ich beginne zuerst mit der Ebene/Stufe, die Gebser als magisch bezeichnet hat. Die Worte Magie und magisch weisen auf auf das Adjektiv geheimnisvoll mit den Bedeutungen, über die auch rätselhaft, unergründlich oder auch dunkel (verborgen) etwas aussagen. Das wir heute auch Zauberkräfte mit diesem Wort verbinden, ist leider etwas ungeschickt, denn Magie (Geheimnis) ist nicht Zauber, sondern Zauber beruht eher auf der Voraussetzung magischen Empfindens und Handelns. Erst kommt das Geheimnis, dann der Zauber dazu und darüber. Irgendwann begann der Mensch damit, Naturphänomene und Natur-Eigenschaften mit Göttern, die in der Umwelt wohnen und sich ausdrücken, zu verbinden. Naturphänomen waren zum Beispiel die Sonne, der Mond, das Meer, Blitz und Donner, Wasser, Wetter und so weiter. Eigenschaften der Natur waren beispielhaft die nächtliche Dunkelheit, die Fruchtbarkeit der Böden, die Fruchtbarkeit und Gesundheit der Menschen oder die Mächtigkeit der Berge. Wenn diese Phänomene zuschlugen, Freunde einfach starben, die Ernte verdarb oder die Natur sich unwirklich verhielt, begannen findige Menschen zu versuchen, die damit verbundenen Götter (in Geschichten überliefert und weitergetragen…) zu besänftigen, in dem man Opfer darbrachte, Beschwörung ausrichtete oder anderen Zauber anwandte. Es bildeten sich Gruppen von Menschen heraus, die im Zaubern (Wahrsagen, Einfluss auf Götter nehmen können, Zeichen deuten…) besonders begabt erschienen und sich daher fast ausschließlich dieser Aufgabe widmeten und von den anderen dafür versorgt und entlohnt wurden. Andere Menschen waren begabt darin, zu organisieren und Gemeinschaften zu bilden, deren Zusammenhalt größere Sicherheit versprach. Andere wiederum waren begabte Kämpfer und Krieger, die große Kraft ausstrahlten, und in der Auseinandersetzung mit den Anderen größere Erfolge versprach. Unter dem Einfluss dieser Entwicklung entstanden die Phänomene Macht, Religion und Krieg, die sich in den darauf folgenden Entwicklungsebenen und weiteren Perspektiv-Bildungen eine herausragende Grundlage lieferten. Diese drei bildeten die wirk-mächtigsten Motive zur Auswahl der Perspektiven, die für die Weiterentwicklung der Kulturen heutiger Prägung von Bedeutung wurden und somit viele andere Sichtweisen in die Verborgenheit verdrängten. Auch die Ich- und Wir-Perspektiven wurden übernommen und weitergetragen, und zwar in beiden Formen: Ich/Wir auf der einen, Der/Die auf der anderen Seite. Man erkennt unschwer die Geburt dessen, was wir heute Dualismus nennen, und damit die Abschwächung der vielen Grautöne zwischen den Gegensätzen, und man erkennt die ersten Herausbildungen von Herrschaftsstrukturen, die im Dualismus gefangen auch gleichzeitig zu Unterdrückungs- und Ausbeutungsstrukturen wurden. Viele Magische Elemente (Zauber, Macht, Krieg) sind bis heute erhalten geblieben und beeinflussen uns auch heute noch. In den Erzählungen darüber wird meist von Epochen berichtet, in den Frieden herrschte und die Götter dem Volk wohlgesonnen waren und natürlich auch von den unzähligen Auseinandersetzungen zwischen den sich bildenden Gruppen.
Mythos: Wie wir oben (Magie) gesehen haben, beruht das magische Weltbild bereits auf einer Erzählung, denn irgendwoher müssen ja die Riten, die Zaubereien und Opferhandlungen, die allgemeine Gültigkeit erlangten, herstammen und sie müssen weitergetragen werden. Auch das mythische Weltbild beruht auf Erzählungen, jedoch sind diese nicht mehr ausschließlich mit Götterbildern verknüpft, sondern es gewinnen zusätzlich zu diesen auch Menschen an Bedeutung, die ich zunächst einmal als Helden bezeichnen möchte. Ganz besonders sind hier die Menschenführer genannt, die die in der magischen Zeit noch in kleinen Verbänden organisierte Menschheit zu größeren Einheiten, in Europa Fürstentümern oder sogar zu Reichen zusammenschließen konnten. Trotzdem wurden die in der magischen Epoche vorherrschenden Phänomene wie der Zauber und die Ich/Wir-Perspektiven auch in die mythische Zeit übernommen, nur eben durch vermehrtes Wissen in etwas abgeschwächteren Formen. Was ich als Mythos bezeichne ist die Zeit der Eroberer, der weisen Herrscher (z.B.: Die alten, noch heute hochverehrten Kaiser in China) und der großen reichen Städte, die ein hohes Identifikationspotential hatten. Ganz besonders beeindruckend belegen das die Inhalte der Erzählungen aus der jeweiligen Zeit; mit anderen Worten: Die Themen, die dazu ausgesucht wurden. Wie auch heute noch zu beobachten, hangeln sich diese von Ereignis zu Ereignis. In der mentalen Struktur erweitert sich das bereits ausgeformte Feld der Funktionen des Bewusstseins, wobei diese später meist nur noch von kriegerischen Auseinandersetzungen oder dem Wechsel der Epochen von Familiendynastien erzählen.
Die mentale Struktur: In der mentalen Geist/Bewusstseinsstruktur vereinzeln und spezialisieren sich die in den vergangenen Ebenen entwickelten Phänomene mehr und mehr. Religiöse Formen, herrschende Formen und kriegerische Auseinandersetzungen werden in ein Spezialistentum versetzt, was aber nicht heißt, das der Austausch zwischen ihnen, die gegenseitigen Beeinflussungen nachließen, im Gegenteil, die Verzahnungen zwischen den Funktionen wurde enger und enger, und es bildete sich Elitegruppen heraus, die diese drei Bereiche besetzt hielten. Diese wurden nach wie vor durch Familiendynastien und Verwandtschaftsbeziehungen gefüllt. Man denke dabei nur an den Begriff des „blauen Blutes“, die für eine adelige Abstammung sprach. Sowohl die Führung der Krieger/Militär, der Religion als auch der Herrscher wurde sozusagen aus einer Gruppe heraus beherrscht. Trotzdem gab es nach wie vor den Zauber in den breiten Schichten der Bevölkerung, nach wie vor waren Abstammung und Blutsverwandtschaft, waren Wir-Gruppen (…contra Die-Gruppen) in ganz entscheidender Weise am Geschehen beteiligt und sehr einflussreich. Und auch die Erzählungen haben sich im Verhältnis zum Mythos wenig verändert. Was sich veränderte, waren die Lebensräume, die durch die technischen Entwicklungen immer größere Ausmaße erreichten und daher immer größere Verwaltungen notwendig machten.
Ein kurz gefasster Zwischenstand: Was wir im großen und ganzen sehen können ist, das in der Ausbildung der Bewusstseinsebenen nicht abgeschlossene Bereiche entstanden und durch Neuerungen ersetzt wurden, sondern das sich bis zum heutigen rationalen Stand ein fließender, unregelmäßiger und nicht zu verallgemeinernder Prozess stattfand, der selbst innerhalb eines Volkes oder gar einer Familie durchaus unterschiedliche Tiefen erreichen konnte. Besonders die Elitegruppen eines Volkes besaß nahezu zu jeder Zeit deutlich mehr an Differenzierung und Bildung als das gemeine Volk oder gar die unterdrückten Schichten. Und auch heute noch zeigen sich die verschiedenen Stufen selbst innerhalb kleiner Einheiten. Ich denke daher nicht, das die Teilung in archaisch, magisch, mythisch, mental und rational in einer verallgemeinernden Form Gültigkeit haben sollte. Jede dieser genannten Stufen bildete einfach neue Perspektiven-Bündel heraus, die aus der ungeheuer großen Vielfalt der möglichen Perspektiven eine Auswahl darstellt, ohne allerdings so gradlinig bei allen Menschen anzukommen. Was wir aber immer wieder beobachten können ist die Neigung, die neu erwählten Bündel als eine neue Basis zu etablieren, unter die zu gehen als Rückschritt oder Regression angesehen wurde. Besonders deutlich ist das im letzten Schritt der Erzählung, die wir das rationale Bewusstsein nennen. Wir können diese Einteilungen in Stufen heute nur noch als ein grobes Mittel nehmen, um ohne großen Text eine Epochen-Prägung zu benennen, aber nicht als Maßstab für eine Beurteilung oder Wertung.
Das rationale Bewusstsein: Diese Stufe ist eng mit der mentalen Ebene verknüpft und stellt eine Pervertierung derselben dar. Heute ist die Welt in allen Räumen erforscht und besiedelt und es gibt nahezu keine Möglichkeiten mehr gibt, in weitere neue Räume und Abenteuer vorzustoßen. Das allgemeine Wissen und die technischen Möglichkeit sind so groß und breit, das sie von niemanden mehr überblickt werden können. Uns seien wir ehrlich, auch unsere Fortschritte in der Digitalisierung bieten da wenig Raum für mehr Übersicht. Wir haben in allen Belangen des Lebens einen so hohen Spezialisierungsgrad erreicht, das ein annähernd natürliches Leben eines Menschen zwischen Nahrungsbeschaffung, Unterkunft und Orientierung nicht mehr oder nur noch schwer möglich erscheint. Die Ich-Perspektive ist rein nur noch in wenigen privaten Räumen anzutreffen, es überwiegt das Wir-Gefühl und die Wissenschaft hoffte, mit der Globalisierung würden wir mehr und mehr die Die-Perspektiven verlieren. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, denn eine wachsende Zahl an Menschen strebt zu ausschließenden Wir-Perspektiven zurück. Unser Wissen beziehen wir heute aus Spezial-Wissenschaften, die nicht mehr miteinander zu reden scheinen und so Techniken in die Welt setzen, die langfristig gesehen zum Scheitern verurteilt sind/sein müssen, weil sie den Bezug zur Ganzheit verloren haben. Wir streben immer mehr zu Nationalismus und Gruppendenken zurück, dabei brauchten die Probleme der Menschheit ein globales Zusammenarbeiten aller Völker. Klima und Pandemien zum Beispiel richten sich nicht nach Grenzen und Ethnien. Vielleicht ist klar geworden, was eine rationale Weltsicht bedeutet. Ich werde später noch im Detail einige der wichtigen Themen einzeln ansprechen.
Fazit: Auf der Grundlage der bisherigen Überlegungen wird schnell klar, das Bewusstsein im heutigen Gewand nicht etwas mit Zeit und Raumphänomen zu tun hat. Das kann nicht (mehr) in Stufen, Entfaltungen oder Entwicklungen gesehen werden, sondern das Ganze sollte als ein Prozess gelten. Der bewegt sich nicht in einer Richtung, sondern stellt aufgrund der Prägungen von Organismus und Umwelt jeweils eine Auswahl der machbaren Möglichkeiten/Perspektiven dar. Aus einer Vielzahl von Erklärungen werden die gerade in der Breite der Bevölkerung durchsetzbaren auswählt. Diese Auswahl ist dann eher mit einer Mutation vergleichbar, die nach einem zufriedenstellenden Bewältigungsmechanismus sucht, der der aktuellen Lage angemessen ist. Und dieser Prozess läuft nicht linear ab, sondern kann sich auch regressiv umkehren, wenn Organismus und Umwelt sich verändern oder das Leben sich erschwert. Ich denke, das sich heute die Menschheit schwer damit tut, vergangene Auswahlen loszulassen und/oder sich zu neuen Ufern zu bewegen. Bei Schwierigkeiten greifen wir lieber auf alte und gut bekannte sogenannte bewährte Auswahlen zurück. Wir glauben zwar, linear fortschrittlich zu denken, haben aber vergessen, das sich zyklische, regressive und selbst weiter zurückliegende Formen hervorragend geschlagen haben und vielleicht heute erneut wieder eine Lösung im neuem Gewand bieten könnten. Auf der anderen Seite bieten sich ständig neue Technologie-Ideen an, die Probleme aller Art in naher Zukunft endgültig lösen könnten. [2. Beispiele könnten sein das Herumspielen an genetischen Materialien, das Spielen mit Massenvernichtungswaffen, um Feinde zu vernichten oder die fortgesetzte rücksichtslose Plünderung der natürlichen Ressourcen, weil wir die irgendwann notwendigen Lösung schon noch rechtzeitig finden werden. Alle drei beruhen auf der Methode, das machbare auch zu tun, selbst wenn es große bis unabsehbare Risiken birgt.]. Zwischen diesen Extremen wanken wir seit Jahrzehnten hin und her, und ich denke, wir können in dieser Zeit nur Glück als Ursache dafür nennen, das es noch nicht laut geknallt hat.
Fassen wir zusammen, was bisher gesagt wurde: Das Aufkommen des Phänomens Bewusstsein beruht auf einem Prozess. Dieser ermöglicht auf der Basis eines organischen Organismus und einem Nervensystem die Ausbildung und Auswertung von perspektivischen Sichtweisen und Bildern. Durch die Vielzahl an Möglichkeiten, die sich daraus bildeten, wurde jeweils die Notwendigkeit geboren, Auswahlen zu treffen, und zwar sowohl aus der Masse der Perspektiven als auch aus der Vielzahl von Erzählungen und Techniken, die sich dann wiederum als Basis für neue Perspektiven, Erzählungen und Sichtweisen und Techniken etablierten. Dieser in vielen Zyklen ablaufender Prozess sorgt aus heutiger Sicht für die Vielfalt an Kulturen, die jeweils eine unterschiedliche kleine Zahl an auswählten Perspektiven als Grundlage für sich priorisierten. Da das Geschehen nicht linear abläuft, es niemals alle Teilnehmer der Gruppen erreichen konnte und auch nicht von allen übernommen wurde/werden konnte, entstand die Vielzahl von Sichtweisen auf Welt und Leben und deren Notwendigkeiten, die wir heute überall wahrnehmen. Selbst innerhalb der Kulturen an sich gibt es eine Vielzahl an Prägungen, die alle Bereiche der gezeigten Entwicklung umfassen können. Auch in der heutigen rationalen Weltsicht samt Aufklärung gibt es Zauber, Heldentum, sich in Ich und Wir ausdrückende Identifikationen und die allseits zu beobachtenden Dualismen, die letztlich auf ein „entweder, oder“-System hinauslaufen. Wir können eigentlich nicht sagen, auf welcher Bewusstseinsstufe wir leben (können/müssen/sollten). Das könnte sich morgen schon, durch Umweltkatastrophen, Kriege oder Seuchen oder auch durch Neuentdeckungen ausgelöst, grundlegend ändern. Letztlich aber sorgt nur das Basissystem Organismus/Umwelt für eine Form, die sich zum Überleben eignet, und nicht unsere gelebte Bewusstseinsstufe. Wir müssen erkennen, das wir (nach wie vor) nicht wissen, wie Leben entsteht und wie es geschützt werden kann. Das zu erkennen wird zur Zeit die hervorstechenste Notwendigkeit darstellen, die es zu berücksichtigen gilt. Dazu müssen wir uns nicht die Theorien und Visionen anschauen, die es in der Ratio so zahlreich gibt, sondern wir müssen uns die perspektivischen Auswahlen anschauen, die wir (sagen wir mal) in den letzten fünf Jahrtausenden getroffen haben und diese ständig neu anpassen und gestalten. Dazu gehört auch, alte Setzungen aufzuheben und neue Auswahlen zutreffen. Diese beziehen sich hauptsächlich auf die Felder Politik (Macht, Herrschaft), Wissen (Wissenschaft, Forschung, Bildung, Technik, Kultur) und Religion (Mythen, Erzählungen, Weisheit, Aufklärung), da auf Grundlage dieser Stichworte sich das Leben (samt Ernährung, Unterkunft und Beschäftigung) heute abspielt. Es wäre angesagt, sowohl die getroffenen Auswahlen und Setzungen als auch ihre Priorisierungen einer erneuten Hinterfragung zu unterziehen. Die dazu erforderlichen Gremien sollten sich aus Spezialisten dieser Themen und aus gesellschaftlich anerkannten Persönlichkeiten zusammensetzen und so gestaltet sein, das die Mitglieder während ihrer Tätigkeit nicht in aktuell anliegende Entscheidungen und Debatten involviert sein sollten. Weiterhin sollten die Gremien zumindest für eine bestimmte Zeit ihrer Arbeit abseits der medialen Aufmerksamkeit nachgehen können. Beispiel dafür könnten die unzähligen Think Tanks sein, nur das sich die Themen, die dort behandelt werden müssten, nicht im Sinne von Elitepositionen, sondern im Sinne der Menschheit und für die Erhaltung unseres Planeten und seiner Vielheit ausgearbeitet werden sollten. Dafür müssten die Gremien, um unabhängig zu sein, von der breiten Allgemeinheit finanziert werden.
Worüber wir reden sollten
Hier in diesem Abschnitt versuche ich einen Überblick zu geben, wie wir uns Bewusstsein vorstellen könnten und wie das Ganze in einem Überblick aussehen könne. Dazu verwende ich zunächst einmal Formatierungen:
Linksbündig erscheinen Begriffe, Aussagen und Definitionen, die nach heutigem Stand als belegbar oder erforschbar gelten.
Rechtsbündig erscheinen solche Begriffe…, die auch heute noch als verborgen gelten müssen und weder belegbar noch erforschbar gesetzt sind.
Mittelbündig erscheinen dann alle Begriffe…, die im Halbdunkel der Wissenschaft und Forschung stehen und daher häufig nur in Theoriebildungen vorliegen.
Über die rechtsbündig formatierten Stichworte wissen wir nichts und es ist unwahrscheinlich für die Menschheit, jemals über diese Inhalte genaueres zu erfahren. Ähnlich, aber mit einem niedrigerem Wahrscheinlichkeitsgrad verhält es sich mit den mittig formatierten Begriffen. Die linksbündig formatierten Begriffe unterliegen unserem Wissen.
Versuch einer Übersicht
Eindeutig belegbar
Sich im Halbdunkel befindend
Verborgen
HOMÖOSTASE
Nicht explizite Fähigkeiten
aller Lebenwesen
Lebewesen mit einem funktionalen
Nervensystem (Tiere)
Pflanzen ?
Speicherung, Erinnerung von Bildern zu(m)
– Eigenwahrnehmung
– Umgebung
– Nahrungsquellen
– Unterkunft und Schutzquellen
Auswertung der Bilder mit nachfolgenden
– ersten Priorisierungen
– Auswahlen für lebensnotwendige Handlungen
– erste Setzungen von Gewohnheiten
Ist das vielleicht die für das Denken des Menschen unüberwindliche Grenze ??!!
KULTUR
Weitere Setzungen aufgrund von
Gewohnheiten und Funktionalität
– Spezialisierung
– Kulturelle Grundannahmen
– Aufbau einer Herrschafts- und Machthierarchie
Weitere Setzungen, die sich aufgrund
der bisherigen Setzungen anbieten und
die Erfolg, Sicherheit und Wohlstand
versprechen
Weitere Setzungen
– dto…
Von der Homöostase zu Kultur
Wie man in dem Versuch einer Übersicht sehen konnte, gibt es zwischen der Auswahl lebensnotwendigen Handlungen, ersten Setzungen und Priorisierungen eine für dem Menschen in heutiger Gestalt überwindbare (?) Grenze. Diese Grenze zurück in Richtung Homöostase zu überschreiten würde die Bedingungen auslöschen, auf die das Mensch-Sein sich heute gründet. Wir können nicht zurück oder hinübergehen, ohne unser Bewusstsein, wie auch immer das definiert werden mag, zu verlassen, denn wir könnten dann unsere Erkenntnisse nicht zurücktragen. Hier irrt Platon mit seinem Höhlengleichnis. In der Homöostase sind die Grundlagen für unser Leben angelegt, und diese sind neben der Nahrungsbeschaffung die Aufrechterhaltung der notwendigen Handlungs- und Schutzmaßnahmen (Ruheräume, Revierabsicherung), die ein einzelnes Lebenwesen zum Überleben und die Gattung als Art (Fortpflanzung, Schutz des Nachwuchses) braucht. Diese Anlagen sind für uns heute zwar nachvollziehbar, ihr Entstehen aber entbehrt jeglicher möglicher Erklärung. Oder um es einfach auszudrücken: Wir wissen es nicht! Wir wissen weder, was das Leben an sich ist noch wie die ersten Regelungen zustande kamen, und wir sollten so ehrlich sein und das auch zugeben. Alle weiteren Ebenen würde ich einer kulturellen Entwicklung zuordnen, denn sie erfolgen aufgrund der im Abschnitt Homöostase dargestellten Grundlagen und sind damit für uns auch hinterfragbar. Irgendwo zwischen heute und dieser Grenze fanden all die Setzungen, Auswahlen und Gewohnheitsanfänge statt, denen wir uns heute ausgesetzt sehen. Und tatsächlich glaube ich, das wir so weit wie möglich dort hinabtauchen müssen, um andere und stabilere Grundlagen für unser Leben in der Zukunft zu finden. Beschäftigen wir uns daher etwas genauer mit diesem Bereich und fragen nach, ob die Entscheidungen von damals auch heute noch Gültigkeit besitzen (sollten). Und ich beginne jeden Abschnitt dieses Kapitels mit einer Frage.
Politik (Macht, Herrschaft)
Stimmt es wirklich, das das Zusammenspiel von mehreren oder vielen Menschen immer einer Führung bedarf, die sich meist in einer Person konzentriert?
Vom Familienoberhaupt über die Clanführer und Dorfältesten geht der bunte Reigen über Häuptlinge, Adelige, Fürsten und Könige bis zu heutigen Diktatoren, Präsidenten und Kanzler, die stets die Macht oder zumindest einen großen Teil davon auf sich vereinigen konnten. Und auch die Mittel und Rechtfertigungen dazu sind uns mehr als deutlich bekannt, die zur Festigung dieser Ämter verwendet wurden. Zuerst waren es immer wohl die Stärksten, die sich der Macht bemächtigen konnten, hier und da auch mal die Klügsten, dann kamen die Schlauen, die Hinterlistigen, die Brutalen und die Gierigen. Dann kamen die zur Macht, die sich gut organisieren konnten, sich verbünden konnten und/oder die größten Reichtümer besaßen. Und das hat sich nicht geändert bis zum heutigen Tag. Wollen wir das wirklich beibehalten? Brauchen wir dieses System wirklich auch heute noch, oder fällt uns da nicht doch etwas Besseres ein?
Mit der Demokratie steht uns doch ein sehr gutes und wirksames Mittel zur Verfügung, um von Missbrauch, Willkür und Gewalt Abstand zu nehmen. Trotzdem haben wir dieses Mittel immer wieder in die alte, unbrauchbare Richtung zurückgedreht. Heute werden zusehens immer mehr Demokratien (heutiger Prägung) in Richtung Oligarchie (Diktatur der Reichen), Ochlokratie (Diktatur der Mehrheit) und Faschismus (Diktatur der Rücksichtslosen) umgewandelt. Ist Demokratie einfach nicht funktional, müssen wir zurückweichen oder doch eher neue Schritte in Richtung einer größeren Beteiligung aller wagen? Und was wären eigentlich die Voraussetzungen, die letzteres zuließen? Sind wir uns als Volk dieser Aufgabe bewusst? Ich glaube: Nein. Wir müssen uns aber damit beschäftigen. Wie wollen wir sonst Kriege verhindern, das Klima retten, den Planeten erhalten und die vielen anderen Aufgaben wie Hunger, Krankheit und andere Katastrophen verhindern? Wie soll das gehen, wenn wir nicht alle gemeinsam an einem Strang ziehen? Wollen wir uns wirklich auf das Hoffen beschränken, das sagt: Es wird schon weiterhin irgendwie gutgehen?
Wissen (Wissenschaft, Forschung, Bildung, Technik, Kultur)
Unsere Zivilisation baut auf Wissen auf, das wir mittels Forschung, Entwicklung und Technik in unser Lebensgefüge einbauen. Dazu benötigt wird im heutigen Verständnis so etwas wie Bildung, das dann mit den Erstgenannten zusammen als Kultur betrachtet wird. Soweit wir zurückblicken können hat uns das wirklich sehr weit gebracht. Das stimmt, aber heute sehen wir, das wir diesen Weg so wie gewohnt nicht weiter gehen können. Unser Erfolg beruht auf der Ausbeutung der Natur. Und er beruht auf der Ausbeutung von Menschen durch den Menschen. Er wird begleitet von Not, Gewalt, Misstrauen, Angst, Aussichtslosigkeit und was sonst noch so alles. Lässt sich das wirklich nicht ändern?
Müssen wir auch hier wirklich zurückweichen in verlassene Positionen, wie das heute vielfach geschieht? Ist mehr Technik wirklich die Lösung für ein gutes Leben? Und sprechen nicht die relativ armen, mit relativ wenig Technik ausgestatteten Völker, die die Glücks-Statistiken seit deren Einführung anführen, nicht doch eine andere Sprache?
Meiner Meinung nach müssen wir die zahlreichen Setzungen, die der Wissenschaft und deren Wirken in das Leben hinein zugrunde liegen, hinterfragt werden. Wir können uns doch nicht darauf berufen, das sich irgendwann einmal in der Zukunft die passende Lösung schon finden lassen wird. Das ging früher einmal, als die Radien der Technik noch gering waren. Heute, bei globaler Reichweite, geht das nicht mehr. Beispiele gibt es reichlich. Die wichtigsten sind doch wohl die Entwicklung von Atomwaffen und die Nutzung von Atomkraftwerken, wo wir doch gar nicht wissen, wie deren Abfälle sicher entsorgt werden können. Da muss es noch nicht einmal Kriege oder Unfälle geben, die uns damit konfrontieren. Das alleinige Vorhandensein ist schon genug, um unbewältigte Probleme zu zeugen. Weitere Probleme bereitet die Herstellung von Kunststoffen, deren Entsorgung zwar möglich, aber noch immer zu teuer zu sein scheint.
Religion (Mythen, Erzählungen, Weisheit, Aufklärung)
Lange Zeit bildeten religiöse Ideen in Form von Erzählungen, Mythen und Weisheitsdichtungen das gesellschaftliche Fundament aller Menschen-Gemeinschaften. Wenn man sich heute diese Geschichten (Narrative) ansieht, wird man sehen müssen, das alle Hinweise einen Kern enthalten, der auf den Anteil der Homöostase im Geiste/Bewusstsein des Menschen hindeutet. Bis zur Aufklärung war Religion die einzige wirkliche Ordnung, die alle Bereiche des Lebens umschloss. Heute hat die Religion und ihre Verwandten nur noch einen geringen Anteil am Lebensgefüge zumindest des westlich rational geprägten Erdenbewohners. Heute sprechen wir mehr von Weltbildern, Staatstheorien oder Dogmen, wenn wir uns auf eine Ordnung beziehen wollen. Das fatale daran ist, das wir zunehmend den homöostatischen Kern vergessen (haben), der uns letztlich begründet. Wir bewegen uns sozusagen nur noch in den Bereichen der Kultur. Da es viele Kulturen gibt, gibt es immer wieder Streit und Auseinandersetzungen um den richtigen Weg. So aber ist Ganzheit in der Welt nicht möglich, denn der Bezug zur Wirklichkeit verschwindet aus dem Gesichtsfeld zugunsten einer Theorie oder eines Abbilds, welche ich weiter oben Perspektiven von Perspektiven genannt habe. Wir verlieren den Bezug zum (unbekannten) Leben.
In vielen Weisheitsdichtungen ist maßvolles Handeln, maßvolle Ausübung von Macht und eine maßvolle Auslegung von „Haben und Sein“ das grundlegende Thema. Wir können den Planeten, der uns trägt, nicht über seine Regenerationsgrenze hinaus ausbeuten. Wir können Macht und Herrschaft auf Dauer nicht so ausüben, das das Gebaren Widerstand erzeugt. Wir müssen die Themenbereiche Gleichheit und Gerechtigkeit in unsere Überlegungen einbeziehen, sonst ist Zusammenarbeit nicht möglich. Und wir müssen nicht nur dem Menschen, sondern auch den anderen Lebensformen Lebens- und Entwicklungsraum ermöglichen. Das Leben in seiner Gesamtheit ist eine Kette. Wenn wir wichtige Glieder darin zerstören, wird alles Leben in Gefahr geraten. Wir wissen zu wenig darüber, um heute schon endgültige Entscheidungen zu treffen.
Ernährung, Unterkunft und Beschäftigung
Wir erfahren heute immer mehr Informationen darüber, wie sich die Lebenswelt entwickelt, zu deren Ausbeuter wir uns aufgeschwungen haben. Und diese Berichte sagen aus, das wir zu viel und zu oft über das Maß hinaus schießen, das die Natur bräuchte, um (noch) regenerieren zu können. Wir fischen die Meere leer, zerstören unsere Anbauflächen durch Überdüngung und chemische Mittel, wir roden die Wälder und versiegeln/verzäunen immer mehr Flächen, die eigentlich Pflanzen und Tieren vorbehalten sein sollten. Und vom Abfall der Industrien, der ja auch irgendwie entsorgt werden muss, haben wir schon gesprochen. Trotzdem müssen sich nach wie vor alle Lebewesen ernähren, müssen atmen können und wollen auch die Menschen in einem natürlichen Umfeld zumindest ihre Freizeit verbringen. All das zusammen funktioniert heute schon nicht mehr, und die Zuwachsraten der Menschheit lässt auch in Zukunft keine Besserung erwarten. Hier müssen dringend Lösung gefunden werden.
Das Bewusstsein ist das Problem, aber auch die Lösung
Alle denkbaren Bewusstseinsstufen des Menschen heute sind unterwegs zur mentalen Ebene, wie sie weiter oben beschrieben wurde. Aus dem Magischen und Mythischen geht es zu mehr Breite zur mentalen Ebene, aus dem Rationalen muss es zurückgehen aus der Perversion auf die funktionale Ebene. So würde Gebser das wohl beschreiben. Und wenn die entscheidende Masse im Mentalen angekommen ist, müsste es zielstrebig weiter ins diaphane Bewusstsein gehen. Wie diese Stufe letztlich aussehen wird, wissen wir heute (noch) nicht. Angesichts der Probleme allerdings, die wir heute weltweit sehen, kann man deutlich die Perspektiven erkennen, die aus den Problemen herausführen könnten. Es gäbe viele Möglichkeiten. Neben neuen Technologien, die alle Probleme lösen, könnte zum Beispiel das Reduzieren der Menschheit eine Perspektive darstellen. In drei Generationen mit einer Einkind-Politik ließe sich das verwirklichen.
Was sich auf jeden Fall sagen lässt ist, das ein zurück in die dunkleren Phasen der Bewusstseinsgeschichte nicht funktionieren kann. Wir müssen uns als Menschen in großer Zahl auf der Ebene einfinden, auf der eine Weiterentwicklung möglich sein kann. Das ist, nach heutigem Wissen die vollständig ausgebildete mentale Bewusstseinsstruktur. Diese enthält die vorgängigen Strukturen in sich, erkennt diese auch an und erweitert so den Schatz an Erfahrung soweit, das sich neue Wege ergeben könn(t)en. Das ist der Stand der Geisteswissenschaften, der Stand der Historienforschung und der Stand der allgemeinen Naturwissenschaften heute. Und so sprechen auch viele spirituelle Traditionen seit alters her. Entwicklung benötigt die Akzeptanz und Offenheit gegenüber allen durchlaufenen Stationen unserer Geschichte. Wir können und dürfen das Alte nicht vergessen und dürfen uns nicht ausschließlich einem Neuen, sei es bekannt oder auch nur erwünscht, zuwenden. Das widerspricht allen Erfahrungen der Menschheit. Wichtig ist aus meiner Ansicht heraus, die uns zugänglichen Perspektiven und Setzungen zu hinterfragen und bessere, weitsichtigere Setzungen zu finden.
Und wozu soll das bisher geschriebene alles gut sein?
Diese Frage stellt sich eigentlich [1. Eigentlich: Sie scheint normal zu sein, ist es aber nicht?!] immer dann, wenn wir uns fragen, wie wir die sehr berühmte Frage nach dem Sinn des Lebens stellen, und wir nicht zugeben wollen, das wir es weder wissen noch wissen können. Wir setzen dabei, die Philosophien von Jahrtausenden zeigen das deutlich, voraus, dass wir entweder auf der Suche nach einem wie immer beschaffenen Urgrund, nach einem außerhalb unserer Vorstellungen und Fähigkeiten liegenden Parallel-Universum (Transzendenz, Dimension) oder aber einem wie immer beschaffenen Schöpfer (Gott, Götter, Herr, Urahn) sind, der uns diese Frage zumindest „phantastisch“ beantworten wird durch Zeichen, Offenbarung, seine Vertreter auf Erden oder einem von vielen angenommenen Glauben. Und das Wort „phantastisch“ trifft diese Aktivitäten wie der Hammer den Kopf, wenn ein Nagel versenkt werden soll. Die gestellte Frage muss und kann aber nur so beantwortet werden:
„WIR WISSEN ES NICHT!“
Das ist unschön und wenig erhebend, aber trotz aller Versuche bisher die einzige richtige Antwort. Natürlich darf jeder Mensch einen Glauben haben. Ja, warum auch nicht? Das Problem dabei ist, das er verstehen muss, das es ein Glaube ist, und das ihm bewusst ist, das das sowohl im Allgemeinen als auch im Besonderen erheblich Schwierigkeiten bereiten wird, den Glauben zu halten und das es daneben unzählige Menschen geben wird, die einen anderen Glauben haben werden. Dieses Wissen ist wichtig, weil es verhindert, das Menschen sich ihres Glaubens wegen verfeinden, sich deshalb gegenseitig bekämpfen und umbringen. Die Geschichte der Menschheit ist voll von Beispielen. Aber der Glaube ist ja nicht die einzige Unsitte der Menschheit. Da gibt es auch noch, wie zuvor schon erwähnt, die Macht und den Reichtum.
Macht hat ein Mensch nicht einfach so. Dazu gehören entweder besondere Fähigkeiten, besondere Erscheinungsformen, gehören Reichtum, der mit der Macht eng verknüpft ist oder aber ein besonderer Status, der von einer großem Mehrheit der geführten Gruppe getragen, geglaubt oder gewährt wird. Macht an sich bringt eine Gruppe von Menschen dazu, sich wie eine Person zu verhalten, die sich sozusagen im Anführer konzentriert. Große Anführer und Machtausübende waren gute Kämpfer, überragende Strategen, wunderschöne, begehrte Frauen und Menschen mit großer Ausstrahlung. Erklären lassen sich in der Aufzählung nur die ersten drei, die letzte bleibt im Dunkel des Unwissens. Was ist Ausstrahlung? Wie wird sie erworben? Worauf beruht sie? Ich halte nach wie vor diese Erscheinungsform für ungeklärt. Wir sollten Ausstrahlung aber nicht verwechseln mit „die Begeisterung einer Gruppe oder Masse wecken können“, „Begierde oder Hass erzeugen zu können“, oder einfach nur ein gut geschulter Redner zu sein. Diese drei lassen sich lernen, denn sie stellen immer nur eine geschickt vermarktete Auswahl möglicher Perspektiven dar. 2000 Jahre Christentum mit all seinen Erscheinungsformen sind ein gutes Beispiel dafür. Ausstrahlung haben nur wenige Menschen. Berühmte Beispiele aus der Neuzeit sind Ghandi, Mandela, King, Beispiele aus der Historie sind Jesus, Mohammed oder Laotse, um nur einige wenige zu nennen. Wenn wir Ausstrahlung begegnen, werden wir es daran bemerken, das weder Begierde noch Macht noch Glauben im Spiel sind. Da ist ein Mensch der strahlt, so ganz ohne Grund. Wir sehen es, können es aber nicht erklären. Und es ist nicht immer nur das Gute, das wir dabei erleben werden. Auch das Erlebnis von Ausstrahlung nämlich kann zur Begierde werden und beraubt uns damit unserer Freiheit.
Alle Phänomen dieser Art müssen uns bewusst sein, wenn wir in ein entwicklungsfähiges Bewusstsein wie das Mentale vordringen oder zurückkehren wollen. Wir müssen sie alle kennen und handhaben können: Begierde, Macht, Besitz, Hass, Ausstrahlung, Begeisterung und so weiter. Und es hilft nicht, das wir das Beachten dieser Kenntnisse dann als „LIEBE“ bezeichnen. Denn mit dieser Zusammenfassung haben schon wieder eine Auswahl getroffen, die von jedem anders interpretiert werden kann. Wir sollten es einfach so benennen, wie wir es auch erfahren. Und das Rätselraten darüber, wohin es eigentlich gehen könne, ist unsinnig. Wir wissen es nicht! Punkt.
Wir hören oft, das so eine Weltsicht Nihilismus sei, eine totale wenn nicht sogar totalitäre Verneinung, die den Menschen Angst machen wird und die daher für eine Gesellschaft schlecht wäre. Ich halte das für einen Irrtum. Ein Mensch, der jegliche Form von Sinngebung verneint, also keinen Glauben annimmt oder kein Ziel wie auch immer geartet verfolgt, ist wenig manipulierbar. Er wird keiner Versprechung nachlaufen, keiner Fahne folgen oder vor anderen aus taktischen Gründen den Bückling machen. Wozu sollte das gut sein? Und ich sage „wenig manipulierbar“, denn er wird sein eigenes Leben und das seiner Lieben beschützen wollen wie alle Wesen auf dieser Welt das so tun. Er stellt sich oder er weicht hier und da auch aus, wenn der/ein Erfolg ungewiss scheint. „Überleben wollen“ gehört zur Homöostase, vielleicht nicht um jeden Preis, aber sicherlich wird das sehr oft das entscheidende Motiv sein, das sich durchsetzt. Und verraten kann man nur einen Glauben, ein Ziel, eine Anhängerschaft oder ein Dogma, und wer diese nicht beherbergt, kann sich auch eines Verrats nicht schuldig machen. Wer kein Ziel kennt, wird auch nicht irgendwann irgendwo ankommen müssen. So einfach kann Argumentieren sein. Und was bleibt ist das Leben in all seiner Pracht und Vielheit. Wir machen Menschen, die wir lieben, gerne zum Geburtstag eine Überraschung. Warum aber lassen wir uns nicht jeden Tag überraschen, vom Leben, von der Welt und von den unbegrenzten Möglichkeiten darin. So würde ich den aus der Mode gekommenen Begriff der WEISHEIT heute definieren wollen. Vielleicht ist das ein bisschen zu einfach, aber wollen wir immer weiter mit undurchschaubaren Definitionen arbeiten? Ich denke nicht!