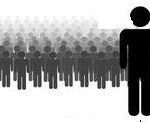Das Ende der Geschichten? Eine Denkreise

Eigentlich, ja
richtig, eigentlich habe ich längst genug von all den Geschichten,
die mir einreden wollen, so und so oder nicht so und deshalb und
darum zu sein. Sie stimmen einfach nicht, diese Geschichten, nicht
hinten, nicht vorne, und in der Mitte ganz und gar nicht. Es gab
historisch niemals einen Anfang, und ein Ende wird es daher auch
nicht geben können.
Tatsächlich
erschließt sich mir das Leben so, dass ich irgendwann aufgewacht bin
und somit einer Welt begegnete, so wie sie einfach ist. Diese Welt
wurde nicht geschaffen, verdankt nichts und niemand ihr Sein, ist
auch nicht von irgendwo gekommen und strebt auch nicht zu einem Ziel
hin. Zumindest gibt es dafür keinen wirklichen Beleg. Sie ist, sonst
nichts. Soweit ist mir die Sache klar. Und weil ich mich in dieser
Welt befinde, bin ich nicht automatisch Herr, Knecht oder Diener. Ich
bin nur ein sehr kleiner Teil dieser Welt wie alle Dinge
einschließlich aller anderen Lebewesen auch. Und ich habe die
Freiheit zu leben wie alles andere auch. Alles und jedes sollte darin
seinen Platz finden und niemand sollte die Möglichkeit wahrnehmen
dürfen, darüber zu entscheiden, was wann und wo etwas sein darf und
was nicht. Doch dieser absolute Anspruch hat seine Grenzen, denn wie
alles mir Bekannte ist „werden und vergehen“ eine der
Grundstrukturen dieser Welt, so wie wir sie nun einmal kennen. Werden
und vergehen in der Welt heißt, geboren zu werden und zu sterben,
darin essen und trinken zu müssen, darin seinen Platz finden und
auch halten zu müssen, darin Träume zu haben und auch
Enttäuschungen zu erleben.
Es ist in meiner Vorstellung einfach nicht so, das geboren zu werden ein Glück, und sterben zu müssen eine Plage ist. Stellt man sich ein Leben ohne sterben vor, so ist unser erster Gedanke bestimmt nicht das Glück, endlich ohne diese Konsequenz ewig in den Tag hinein zu leben. Ohne ein Ende zu leben heißt, dass nichts mehr Bedeutung gewinnt, nichts mehr sich verändert, nichts mehr geschieht, alles so bleibt, wie es ist für die Ewigkeit. Der gleiche Tag immer wieder, kein älter werden, keine Erfahrung sammeln, keine Freude über Neues oder Sinnstiftendes mehr finden. Irgendwann weiß ich alles und fange nichts damit mehr an, weil es egal geworden ist. Wie trostlos, wie leer. Obwohl, wie „leer“ zu sein ist für viele Menschen schon ein Anreiz. Viele spirituelle Traditionen werben mit diesem Ziel, halten leer zu sein (im Denken) für das Ziel aller Ziele. Ist das aber wirklich so? Ist es wirklich das Ziel dieser Verfahren, „leer“ zu sein in diesem Sinne. Ich glaube das so nicht. Leer zu sein als Ziel der Meditation heißt nicht nicht zu denken. „Leer zu sein“ heißt, dem Werden und Vergehen, dem Wandel nicht im Wege zu stehen, der alles Lebende auszeichnet. Es heißt, auf dem Weg der Wandlung zu leben, mehr noch, diesen Pfad zu sehen und ihm zu folgen, ohne Widerstand, ohne all die Emotionen, Wünsche und Ziele, denen wir so schöne Namen gegeben haben wie Begierde, Zorn, Hass, Neid, Wahn, Lust oder Macht. Einfach tun, was das Leben, das ich führe, verlangt, zu essen, wenn es hungert, zu schlafen, wenn es müde ist, sich einen neuen Platz zu suchen, wenn der alte nicht mehr für das Leben spendet. Und das dabei nicht alles gelingen kann, sollte uns nicht wundern. Wenn viele eine Platz für sich suchen, wird es auch Reibung geben, zumal unser Planet sich mit immer mehr Menschen füllt. Es ist daher nicht verwunderlich, das die Weisen aller Traditionen sich stets in die Einsamkeit zurückzogen. Denn wer dieses leere Leben für sich zu leben anstrebt, stößt regelmäßig mit denen zusammen, die diese Erkenntnis nicht machen konnten oder diese gar ganz und gar ablehnen. Das war früher so, das ist heute so und wird in Zukunft auch so bleiben.
Das Lebewesen sich
ernähren müssen, das Lebewesen sich nur von Leben ernähren können,
ist eine Binsenweisheit. Auch das Salatblatt ist schließlich Leben.
Es stellt sich aber nicht die Frage, ob wir es tun müssen, sondern
die Frage lautet vielmehr: Wie wir es tun, damit auch anderes Leben
seinen Raum behalten kann? Muss sich, um Klartext zu reden, der
Mensch immer weiter ausbreiten und diesem Planeten ersticken? Und
muss sich der Mensch so maßlos bedienen an den Ressourcen der Natur,
das der ganze Lebensraum immer schneller im Chaos versinkt? Wir
Menschen leben ja auch nicht in Gemeinschaften, auch wenn das immer
so erzählt wird, sondern wir leben in Parzellen, eingezäunt,
gepflegt. Wehe dem Unkraut, das sich auf den heimischen Rasen
verirrt. Wir leben von anderen Parzellen isoliert und sind für alle
Lebewesen, die wir nicht niedlich finden, unzugänglich. Auch der
ungeliebte Nachbar, Mensch seinesgleichen, findet keinen Zugang in
unsere heilige Parzelle. Ist das Gemeinschaft, Gemeinschaft unter
Menschen, Gemeinschaft unter Lebewesen, in der Natur, in der Welt?
Ist es wirklich das Ziel des Lebens, in Parzellen zu wohnen? Geht
weiterhin das Töten, das wir tun müssen, nur so wie wir es jetzt
tun? Müssen wir unser lebendes Essen in Schachteln aufziehen, an
einem artgerechten Leben hindern von ersten bis zum letzten Tag, oder
geht das auch anders? Das sind Fragen, die auf den Nägeln brennen.
Ich sehe nicht einmal einen Anfang einer Antwort, die als Lösung
Bestand haben könnte.
Und dann hatte ich
noch die Träume, Wünsche und die Enttäuschungen genannt, die
ebenso zum werden und vergehen gehören wie die schon ausgeführten.
Was sind Träume? Woher kommen Wünsche? Was ist eine Enttäuschung?
Diese Fragen sind schwer-wiegend und weit-reichend, denn sie
bestimmen den Großteil unseres mentalen Lebens. Wo kommen Träume
her, nicht die, an die wir uns morgens nach dem Erwachen dunkel
erinnern, sondern gemeint sind die Träume, die zum Leben erweckt
werden, indem ich strebe, verfolge, entwickle und investiere. Es sind
die Träume, die uns einen Tag überstehen lassen, der, seien wir
ehrlich, nahezu keine Zeit mehr lässt zum Leben. Und haben wir es
dann geschafft, ein Leben eingerichtet, so wie es eben geht, dann
kommen die Wünsche, die uns immer weiter treiben. Wünsche sind,
wenn wir ehrlich gestehen, all das zu besitzen, zu tun und zu leben,
was andere auch getan, bekommen oder verdient haben. Was ich nicht
kenne, wünsche ich nicht. Ich kann nur wünschen, was ich kenne, und
da ich etwas zu haben wünsche, das ich noch nicht habe, kann es nur
etwas sein, was andere mir gezeigt oder erzählt haben. Krass
gefragt, muss ich, um wer zu sein, auf dem Mount Everest gestanden
haben? Ich war mal auf dem höchsten Berg Deutschlands, der
Zugspitze. Sie lag voll im Nebel, und ich habe nichts gesehen außer
Wänden, Schnee und habe dort eine Gaststätte besucht, in der
schlechtes Essen verkauft wurde. War das eine Enttäuschung? Nein. Es
gibt Fotos, die ich auch im Internet mir hätte ansehen können. Aber
ich konnte wochenlang erzählen, auf der Zugspitze gewesen zu sein,
und ich konnte auch die Bilder zeigen, die ich gekauft hatte. Was für
ein Irrsinn. Eine Enttäuschung ist das herausfallen aus einer
Täuschung. Ich hatte sozusagen etwas falsches im Kopf und musste es
bemerken. Ist das gut oder schlecht? Die Frage ist nicht so einfach
zu beantworten. Denn wenn ich den Berg nicht besucht hätte, würde
ich von anderen als träge eingestuft. So war es halt nur ein Pech
mit dem Wetter. Somit wäre in diesem Fall eine Ent-Täuschung
gewesen, wenn ich gelernt hätte, das etwas zu tun, um erzählen zu
können, schlichtweg nicht der Freude meinerseits, sondern dem… ja
was eigentlich, dem
Neid der anderen Futter gibt?
Jetzt
mal ganz ehrlich? Ist das alles, was ich hier bis jetzt geschrieben
habe, nicht traurig und desillusionierend? Dieser
Inhalt ist mir eingefallen,
als ich einen Brief eines Freundes zu beantworten begonnen hatte. Der
Hilferuf lautete kurz gesagt etwa so: Wie
die Stille und die Ruhe zu
Hause denn zu ertragen
ist, wenn es gelingt, diese sich auch
einfinden zu lassen. Ich
habe diesen Brief mit den nachfolgenden Zeilen beantwortet:
Was ich bemerkt und in letzter Zeit aufgenommen habe ist die Tatsache, dass man sich selbst nicht ändern kann und auch nicht braucht. Eine verrückte Ansicht? Nein! Meiner Meinung und Erfahrung geht es einzig und allein darum, sich bewusst zu werden, was im Leben nicht stimmt. Und dann, wenn das geschehen ist, aufmerksam zu sein und möglichst früh zu bemerken, wann ich wieder mal geneigt bin, wie gewohnt in die falsche Richtung zu steuern. Und dann ist es relativ einfach, sich eine andere Neigung zu geben. Das ist ein wenig so wie auf einem Brett zu balancieren. Zunächst ist die Ausgleichsbewegung grob, aber mit der Übung wird sie immer feiner, und bald entwickelt sich das, und du brauchst die große Aufmerksamkeit nicht mehr, weil die innere Natur gelernt hat, auf dem Brett stabil zu sein. Ein Prozess wie ein Leben ist etwas fließendes, das nicht aufgehalten werden darf, um laufen zu können. Grobe Korrekturen stören das Fließen. Daher spreche und handle ich mehr von Änderung, sondern mehr im Sinn von Neigung oder geneigt sein, und überlasse den Rest dem „in der Welt sein“. Es geschieht, und ich lasse geschehen, und wenn es falsch läuft, neige ich mich in die mir besser erscheinende Richtung und warte geduldig auf die Richtungsänderung. Aber ich bleibe nicht stehen, kehre nicht mehr um, versuche nicht mehr mich umzubauen oder vertiefe mich nicht mehr in die Geschichten, die eigentlich nur trösten sollen. Das ist eine etwas selten angewandte Art der Wandlung, die gerne in der Psychologie und Philosophie übersehen und wenig kommentiert wird, weil sie keine Brüche erzeugt, die zu einem Ahaaa- oder Ohhh-Erlebnis führen, was Auflage schafft und wissenschaftliche Diskussionen erzeugt. Der Wandel darin entsteht still und leise und eckt nicht nur nicht an, sondern geht mehr wie selbstverständlich über die Bühne. Das ist meine neue Art heute, mich zu wandeln. Das gibt mir Frieden und lässt mich jetzt selbst in der Langeweile des Rentnerlebens noch getragen und still sein.
Was
heißt das jetzt im Kontext eines Lebens? Was
tun? Was denken? Wie antworten?
Wir
leben alle in unseren Geschichten. Diese bilden nämlich die Basis
für unser Denken. Denken findet nicht in der Welt, sondern auf den
mentalen Ansichtskarten der Welt statt. Ohne die Begriffe, die Dinge
auf den Karten in Absprache mit anderen erhalten, können diese nicht
in Beziehung zueinander gebracht werden. Die Begriffe wie Namen und
deren Erscheinungen, Bewegungen, Veränderungen bilden Sprachen.Was
in der Sprache, die wir zu sprechen gelernt haben, abgebildet werden
kann, ist die Basis unseres Denkens. Hier
entstehen diese Träume, Wünsche und Enttäuschungen, um nur drei
Motive zu nennen. Worüber wir uns also klar werden müssen, ist die
Beschaffenheit dieser Basis des Denkens. Was sagt diese Basis über
unser Leben aus?
Da
ist, um irgendwo zu beginnen, die Aussage: Ich denke…
Und da wir glauben, das
begründen zu müssen,
heißt es: …also bin ich. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich.
Um sich diesen Satz in seiner Nützlichkeit
klarzumachen, genügt es, einfach mal von einem anderen Ding
auszugehen und zB. zu sagen: Es hat
eine Eigenschaft, also
ist es: Wasser ist nass,
also ist es. Aber der
Fehler liegt ja nicht, wie
wir sehen werden, nur in
der Schlussfolgerung,
sondern schon in der Absicht,
die erlebte
Wirklichkeit
begründen zu müssen. Das muss ich nicht!
Grabe
ich weiter, komme ich zu der Frage, die da heißt: Ich bin?
Oder anders gefragt: Bin ich? Was heißt das? Sein, so wie es gedacht
wird, setzt eine Substanz,
einen Geist voraus, der nicht dem Leben unterliegt, der also nicht
vergeht, somit ewig ist. Wäre das nicht ewig, wäre „Sein“ eine
falsche Aussage, denn sie hätte Anfang und Ende und würde vergehen,
also nicht ewig sein.
Somit müsste ich mich fragen, ob sich in der Basis meines Denkens
nicht schon einen Fehler eingeschlichen hat, denn ob es diese
Grundsubstanz/Geist überhaupt gibt, weiß ich nicht.
Und
dann ist da ja noch das „Ich“,
das denkt, also auf der Karte mit den Namen der Dinge Beziehungen und
Einteilungen vornimmt und zu Schlussfolgerungen kommt. Wenn ich einen
Stein von Ort A nach B verlege, habe ich etwas getan. Das „Ich“
ist dabei das Lebewesen Mensch, das in der Welt lebt und wahrgenommen
hat, einen Stein verlegt zu haben. Ist klar, also worüber reden wir
eigentlich? Wenn ich aber nur
die Absicht bekunde, einen
Stein von A nach B verlegen zu wollen, wer ist „Ich“
dann? Ist
die Idee bereits eine Substanz, ein Geist, oder was auch immer? Was
ist, wenn ich den Schwerpunkt meines Denkens auf die Frage lege, was
der Stein auf B in Beziehung zu A bedeuten könnte, wenn
ich ihn verlegen würde? A
und B sind darin Punkte auf einer gedachten, abgesprochenen
Landkarte, deren Existenz nicht wirklich belegbar ist. Und dann…
Diese
unsinnige Satz
ist doch nur der Anfang einer endlosen Diskussion, die wie ein Keim
immer neue Keime produziert. Das geht weiter und weiter und weiter…
und was daraus entsteht sind:
Träume, Wünsche und Ent-Täuschungen. In
der Basis unseres Denkens gibt es viele Sätze dieser Art, die
zerpflückt schlicht und einfach nichts bedeuten, nichts
bewirken und aussagen.
Viele davon sind einfach
nur falsch oder
zeigen sich als willkürlich gesetzt: Ich komme leer auf die Welt und
habe die Aufgabe zu lernen. Da war/ist ein Gott, der das so wollte
und das getan hat. Er hat mich erschaffen nach seinem Ebenbild. Daher
darf ich als auserwähltes Ebenbild (Der
Esel zum Beispiel darf das nicht.)
auch oft Gott
spielen. Gott macht keine Fehler, also sein
Ebenbild auch nicht. Mein
Lernen orientiert sich an den Beispielen, die mir in
den Jahren der Ausbildung begegnen.
Vater, Mutter werden von
mir kopiert, und ihr
Lebensablauf bestimmt somit direkt den meinen. Verlieren Eltern in
der Pubertät ihre große
Bedeutung,was
gar nicht so selten
vorkommt, übernehmen
Vorgesetzte, Promis und Freunde diese Aufgabe, mir ein Beispiel zu
sein. Und die gemeinsame Sprache samt den damit erzählten
Geschichten bilden zusammen
eine Kultur, die ebenfalls
und fortschreitend mir als
Beispiel dient. Und so geht das weiter und weiter und weiter…
Seien wir ehrlich! Nichts davon ist wirklich als Notwendigkeit belegt. Und wahr wird es erst dann, wenn ich dem auch bereitwillig mit Taten oder Denkvorgängen folge. Soll ich also nicht folgen? Oder soll ich dem nur nicht immer folgen? Soll ich also alles und jedes hinterfragen? Wie soll das gehen? Wonach entscheide ich? Muss ich mich immerzu entscheiden?
Fragen wir doch einmal anders herum: „Muss ich überhaupt einen Plan haben, um zu leben?“ oder auch mal: „Ist mein jetziges Leben gut oder schlecht; lebe ich also verkürzt gefragt unter gerechten oder willkürlichen Bedingungen?“. Das sind scheinbar banale Fragen… auf den ersten Blick, denn ein zweiter Blick beschert mir genau genommen viele weitere Fragen, und die Antworten sind nicht automatisch in den Fragen enthalten, sofern das, wie die Philosophie verkündet, die falschen Fragen waren. Es sind eben grundlegende Fragen, die ein alltägliches Fragen, ein Suchen und ein Finden-Können erst begründen. Wenn es mir also gut geht, gibt es wohl keinen Grund, mein Leben zu ändern? Wenn es mir folglich schlecht geht, sollte ich aber mein Leben verändern! Aber geht das? Es scheint ja nicht so einfach zu sein. Wenn ich unter gerechten Bedingungen lebe habe ich Glück, unter willkürlichen Bedingungen dagegen hatte ich bis heute Pech. Stimmt das? Und wenn „ja“, kann ich das ja wohl nicht so einfach ändern. Und dann dazu eine alles entscheide Frage: „Gibt es Glück und Gerechtigkeit überhaupt? Und was muss geschehen, damit diese Frage sich beantwortet? Genügen dazu Definitionen? Brauche ich Moral, Ethik, Religion und Dogma, um eine mir genügende Antwort zu finden?
Wir sehen, unsere gewohnten Denkweisen finden hier, falls überhaupt, nur sehr holprig einen Zugang zu Antworten. Das ist so, weil wir in festgelegten Motiven, Schemen, Formalitäten, Gewohnheiten, Verfahrensweisen, Riten und Gesetzen denken. Sogar der Vorgang des Trauerns hat eine bestimmte und von allen einzuhaltende Form. Die normale Trauer ist meist in unserer Kultur ein Spiel, eine Maske, ein vorgegebenes Verhalten. „Nicht schlecht über den Toten sprechen…“, die echte oder auch unechte Trauer der anderen nicht durch Freude stören ist das Gebot auf dieser Veranstaltung. Etwas wird geschützt, das vielleicht gar nicht echt sein muss, und vielleicht wird etwas unterdrückt, was wahr ist. Und dieses kleine Beispiel steht stellvertretend für all die ungeschriebenen und geschriebenen Gebote, die unser Leben bestimmen.
Geht das auch anders? Das ist eine im Moment zumindest die erste wirklich produktive Frage dieses Artikels.
Wir hören oft, wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen, das wir uns selbst oder unsere richtige Mitte finden müssen. Ratgeber, Zeitschriften und Bücher sind voll davon. Aber unser „Selbst“ ist, wie oben bereits hinterfragt, doch nur ein Name ohne Substanz, ein Zeichen auf der Landkarte. Das als Substanz behandeln zu wollen [Mein Selbst ist…], wie es im Ratgeber-Milieu oftmals geschieht, ist ein fragwürdiges Verfahren. Gleiches gilt übrigens auch, die Theologie bitte ich um Verständnis, mit einer wie immer gearteten Seele oder Monade. Und auch die Existenz eines Atman ist nebenbei erwähnt bisher unbelegt.
Und die Mitte? Ja, das ist ein Problem für sich, das einige Worte mehr bedarf. Ist die Mitte wirklich nur das mathematische Mittelding zwischen zwei Extremen? Was ist das Mittel zwischen gut und böse, heilsam und schädlich, nützlich und sinnfrei: Langweilig vielleicht? Wie findet ein Mensch, der geliebt werden möchte und niemanden findet, der dieses Gefühl in ihm auslöst, seine Mitte? Wo ist die Mitte in der Gesellschaft? Und ruht die Mitte immer, oder kann sie auch bewegt sein? Was ist diese Mitte eigentlich? Meiner Ansicht nach sind das gute Fragen, und gute Antworten darauf sind eher rar.
Beginnen
wir mit einem Zitat eines China-Kenners und Philosophen, Francois
Jullien (aus „Der Weise Hängt An Keiner Idee“, Seite 33):
… Diese „rechte Mitte“
ist deshalb „recht“, weil sie reguliert ist: Man verharrt oder
„erstarrt“ in keiner Position, sondern bewegt und entwickelt sich
unablässig, um sich der Situation anzupassen; es gibt zwar eine
„Mitte“, doch ist sie doppelt: Sie befindet sich an den beiden
Extremen, die beide jeweils in sich legitim sind…
Sich
der Situation anzupassen, sich seiner Möglichkeiten bewusst zu sein
und im Bereich des nützlichen, möglichen und legitimen, vielleicht
sogar zusammenfassend gesagt
im „Heilsamen“
dieser Spanne zu handeln,
nennt man in China, im chinesischen Denken die „rechte Mitte
wahren“. Das ist etwas anderes als Mittelmaß oder im ängstlichen
„sowohl als auch“ sich von Ausprägungen und Festlegungen
fernzuhalten. Das kann heißen, das eine Mal über die Strenge zu
schlagen und an einem anderen Tag schlicht „nein“ zu sagen zur
selben Anforderung, und dazwischen liegt ja noch der ganze
Graubereich, der ebenfalls legitim sein kann. In dieser Spanne ist
eine Lebendigkeit möglich, die fast das Gegenteil zeigt von der
Starre eines Mittelmaßes, wie es in Europa gedacht wird.
Brauchen
wir Ratgeber um zu leben? Brauchen wir immerzu einen Plan? Müssen
wir wirklich alles wissen und durchdringen, was uns im Leben begegnen
könnte? Müssen wir uns auf jedes erdenkliche Szenario vorbereiten?
Und wie viel Vorsorge und Vorarbeit ist wirklich nötig, um glücklich
und frei leben zu können? Ich habe den Eindruck, das wir niemals
fertig werden mit den Anforderungen, die wir uns selbst immerzu
stellen. Wir hetzen sozusagen
einem Ideal hinterher, das
viel zu
hoch gehängt ist und
daher niemals zu
erreichen ist. Im Buddhismus werden alle Forderungen an einen Mönch
mit „der (die, das) rechte…“ begonnen. Sollten wir nicht auch
unsere Ängstlichkeiten, unsere Anforderungen an unser
Selbst und an die Welt um uns herum nicht auch
mit dem Wort „recht(e)“
beginnen? Und was legt dann fest, was das „rechte Maß“ dieses
„rechten“ ist? Vielleicht
sollten wir einmal beginnen, dieses rechte Maß nicht festzulegen für
alle Zeit, sondern intuitiv und spontan im Augenblick einfach nur das
„rechte“ zu tun und darauf vertrauen, das das Leben lebt und
keinen Plan braucht, um zu gelingen. Ein Haus bauen zu wollen braucht
einen Plan, ein Leben zu
bauen eigentlich
nicht. Leben, wissen,
lernen, bedenken und sich vorstellen wie gewohnt, zu wissen, was
„recht“ ist, aber offen und unentschieden bleiben für den einen
Augenblick, in
dem sich das Handeln lohnt
und vertrauen darauf, das es geht.
Das wäre doch mal ein Plan, etwas ungewohnt vielleicht,
aber doch bedenkenswert.
Nun
mehr, aus Seite 5 angekommen, frage ich mich, was um alles in der
Welt habe ich hier zu Papier, nein, zu „Bits“ gebracht? Und wie
komme ich darauf, so etwas zu einem
Text zusammen
zu schreiben?
Ich nenne das Geschriebene
nach kurzer Überlegung
jetzt einfach einmal eine
Denkreise,
ausgelöst durch einen Brief, ein Telefonat oder ein Gespräch denke
ich schreibend darüber
nach, woher und warum diese Kommunikation so
zustande kam, was
ich ausgelassen, nicht erwähnt, nicht bedacht habe oder haben könnte
und schreibe das einfach so mal auf. Eine Denkreise eben, inspiriert
durch den Begriff der Phantasiereise, und ich
füge das jetzt
ebenso einfach der
Überschrift hinzu. Eine
Denkreise in diesem Sinne verfolgt keinen Plan, kein roter Faden
zieht sich durch den Text und keine Botschaft wird verfolgt. Es steht
da einfach so da, wie es in den Kopf geschossen kam.