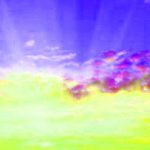Eine andere, etwas philosophischere Lebens-Sichtweise auf die Körper-, Atem- und Meditationsarbeit mit Yoga. Was Yoga und die Essenz der anderen Praktiken heute ist und sein kann, sein soll und wie die Übungen gesehen, praktiziert und verstanden werden können ist in unzähligen Büchern, Schriften und Veröffentlichungen mehr als überdeutlich belegt. Wie nimmt man zum Beispiel Asanas wie Drehsitz oder Kopfstand ein, welche Körperpartien werden dabei bearbeitet, welches Energiegefüge wird dabei angesprochen und was sind die überwiegend positiven Wirkungen der Übung ist in vielfältigen Quellen mehr als ausführlich dargelegt und braucht keine weiteren Versuche.
Es gibt zwar immer wieder kleine Neuerungen, aber in Großen und Ganzen gesehen ist die Arbeit des Beschreibens weitestgehend getan. Gut, es gibt immer wieder neue, warnende Hinweise, die Übungen nicht zu übertreiben, nicht alle einfach so anzunehmen und diverse Vorsichtsmaßnahmen, besonders für Menschen mit den üblichen Zivilisationsleiden [1. Bluthochdruck, Rückenleiden, Gefäßerkrankungen, Herzschwächen, Übergewicht, Diabetes, usw.] zu beachten. Weiterhin werden immer mehr Verknüpfungen vorgenommen, die aus unterschiedlichen Traditionen stammende Übungen, Motive und Praktiken zusammenfügen [2. Tao-Yoga, Hormon-Yoga, Thai-Yoga] und die Möglichkeiten, etwas für sich selbst zu tun, immer stärker erweitern. Und ich möchte diese Trends auch gar nicht angreifen oder relativieren, auch wenn ich für mich persönlich nicht alle Kombinationen für sinnvoll erachte. Im Gegenteil, ich bin froh darüber, das immer mehr Menschen erkennen, das körperliche, geistige und seelische Gesundheit einen großen Wert besitzen. Ich möchte auch niemanden davon abhalten, sich einer der genannten Praktiken zu verschreiben. Allerdings muss ich der Möglichkeit warnen, die immer vielfältigeren Praktiken wie Romane zu konsumieren und regelrecht in ein Stil-Hopping zu verfallen, anstatt sich einer einzigen Praxis anzunehmen, sich darin immer mehr zu verfeinern und zu wachsen. Es geht nicht um Masse und das übliche „immer mehr Desselben“, sondern dem Gedanken, das man immer nur einem Weg zielführend folgen kann. Diverse Wegkreuzungen und Gabelungen gibt es im Yoga immer mehr, und im Versuch, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, bleibt der Übende beim Hopping im Grunde in einem permanenten Anfängerdasein gefangen. Nun ist es schon gut sich viele Stile anzuschauen, aber das kann und darf in meiner Überzeugung nicht in einem stetigen Wechsel der Praxis-Grundlagen enden. Ich habe mir selbst auch viele Stile angesehen, habe einige Lehrer konsultiert und mit Fragen genervt, aber diese Neigung hat nie dazu geführt, den Weg zu verlassen, zu dem ich mich entschlossen hatte. Ich war und bin heute immer noch der Ansicht, das Neugierde eine gute Eigenschaft des Menschen ist und daher auch im Yoga seinen Platz hat. Und ich möchte im folgenden den Versuch wagen zu erklären, wie ich das heute, nach 30 Jahren Praxis, noch immer sehe.
Zunächst einmal sei grundsätzlich gesagt, das es für mich im Yoga mehr um „Sein“ geht und nicht so sehr um „Haben“. Das führt dazu, das ich auf der einen Seite nicht alles wissen muss, was über Yoga und seine Intensionen gesagt, geschrieben und berichtet wird. Ich muss auch nicht alle Muskeln kennen, die eine Asana anspricht, nicht alle Wirkungen auf Organe und Psyche kennen, alles verstehen und darüber auch noch dozieren können. Das alles ist das, was mehr zur Kategorie Haben gehört. Auf der anderen Seite geht es, obwohl Yoga im Unterricht, besonders für mich als Lehrer, nicht ganz ohne Haben-Inhalte zu präsentieren geht, tatsächlich viel mehr um Erleben und Erkennen in der Praxis. Und die Aufgabe als Lehrer ist es, seine Teilnehmer im Unterricht dorthin zu führen, wo erleben, erkennen und wahrnehmen möglich ist. Das ist nicht immer einfach, nicht immer nach Vorgaben zu erreichen und bedarf viel Ausdauer und Geduld auf beiden Seiten. Zum einen muss der Lehrer die notwendige Zeit erhalten, um seine Teilnehmer einschätzen zu können und das notwendige Vertrauen aufzubauen, zum anderen muss der Teilnehmer dem Lehrer das Kennenlernen ermöglichen und warten können, bis der Vertrauenspegel die notwendige Stärke erreicht hat. Nur unter Bedingungen des Vertrauens können Lehrer und Teilnehmer eine für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit bewirken.
Und eine weitere Schwierigkeit tritt auf, wenn man mit Yoga beginnt: Yoga beginnt dort, wo der/die Übende in der eingenommenen Haltung, ob vollständige Asana oder Vorübung ist dabei unerheblich, entspannen kann. Mit Entspannung ist hier gemeint, den Körper in seiner Gesamtheit aus jeglichen unnötigen Spannungen zu befreien. Gerne wird das mit dem Wort „loslassen“ eingefordert. Dazu muss man wissen, das eine Haltung, und Asana ist Haltung, immer irgendwo gehalten werden muss. Selbst das Stehen in Tadasana, ja sogar das Liegen in Shavasana benötigt hier und da im Körper eine Haltespannung, sonst fällt der Körper aus der sicheren Haltung heraus und/oder bedroht sogar seine lebenswichtigen Funktionen wie Atmung und Kreislauf. Schon in der Hatha-Yoga-Pradipika ist diese Bedingung beschrieben. Das bedeutet, das die/der Übende unterscheiden können muss, was notwendig ist und was überflüssig zu sein scheint. Hier kann der Lehrer nur bedingt helfen und muss den Aussagen seiner Teilnehmer vertrauen können. Nach der Entspannung des Körpers in besagter Weise folgt nach der Pradipika das Einrichten und anschließende Loslassens des Atems. Darauf erfolgt dann nach einer Gewöhnungszeit die Stille des Geistes, was zu den Yoga-Stufen 5-8 die Zugänge öffnen wird. So sieht der Weg des Yoga ungefähr aus, wie er in den Schriften von alters her beschrieben wird. Rekapitulieren wir, was als Einstiegsbedingung für den Yogaweg gefordert wurde und auch heute noch erforderlich ist:
- Die größtmögliche Entspannung des Körpers in Asana, …
- … gefolgt von einem eingerichteten und losgelassenem Atem und …
- … der darauf folgende Stille des Geistes, die zur Meditation den Zugang öffnet.
- Meditatives Verweilen in Asana öffnet somit die Wirkungen des Yoga.
Und an dieser Stelle beginnt Yoga erst zu einem Weg zu werden. Davor werden lediglich die Grundbedingungen geschaffen. Das Yogaübungen auch ohne das Betreten des Weges begangen werden, hier und da Fehlhaltungen beseitigen können und der Gesundheit ganz generell dienlich sind, steht damit nicht in Frage. Aber seine wirklich Pracht entfaltet Yoga erst nach Erreichen der genannten Bedingungen. Was sind die Wirkungen, was entfaltet sich dann in der Übung? Nun ist das so einfach und leicht nicht zu beschreiben. Nahezu alle Schriften verweisen darauf, das die geheimen Wirkungen nicht preisgegeben werden sollen, denn sie können den unvorbereiteten Menschen nicht nur keinen Nutzen bringen, sondern sogar schädigen. Nun sind nicht alle Wirkungen Siddhis, wie die geheimen Fähigkeiten im Yoga genannt werden. Einige der wenige spektakulären Wirkungen sind durchaus beschreibbar.
Beginnen wir zunächst einmal, den übenden Menschen unter genannten Vorbedingen zu beschreiben. Nehmen wir dazu als Asana einen Menschen im Drehsitz. Mit einer ausreichenden körperlichen Beweglichkeit [3. Auch ein sinnvoll verwendetes Hilfsmittel wie ein Gurt kann die Haltung vervollständigen. Besonders korpulente Menschen können die Bindung des Drehsitzes mit den Armen nur selten bewerkstelligen.] ist der Drehsitz für den Übenden nahezu mühelos. Bei gelungener Bindung ist lediglich für den aufrecht gehaltenen Kopf etwas Spannung nötig. Die Atmung kann mühelos ihre Bahnen ziehen und der Sitz an sich ist vollständig eingebettet, so das die Teile des Körpers wie im Aufbau einer Pyramide ein festes, mühe- und reglos gestaltetes Sitzen ermöglichen. Und dann alles unnötige entfernen und für eine Minute lang Stille aufkommen lassen: Ein Genuss ohne gleichen. So oder ähnlich können nahezu alle Asana praktiziert werden, auch Gleichgewichtsübungen und Haltungen, die hier und da einen Krafteinsatz fordern. Das Zuviel entfernen ist loslassen, den Atem einrichten und ziehen lassen und dann die Stille des Geistes genießen, so erfolgt der Weg des Yoga in der Körperübung. Ähnlich, allerdings im Detail den Haltungen angepasst erfolgt auch Pranayama (Atemübung) und Meditation. Immer ist eine Haltung zu stehen, sitzen oder liegen, immer ist zu atmen, immer ist Ruhe zu halten im Geist. Und so geübt werden die Wirkungen des Yoga sich entfalten.
Nun werde ich nicht die besonderen übermenschlichen Fähigkeiten beschreiben, die verschiedene Autoren dem erfolgreichen Yoga zuschreiben. Das ist, ich hatte es erwähnt, nicht sinnvoll. Aber ich kann über Wirkungen berichten, die sich ergeben können, wenn Menschen mit Defiziten beginnen mit Yoga zu arbeiten. Und seien wir ehrlich: Defizite haben wir in Europa alle, seien es körperliche, organische oder psychische. Stress, falsche Ernährung, Überlastung, falsche Vorstellungen und überzogene Wünsche seien hier beispielhaft genannt. Und ich nehme mich selbst dabei nicht aus. Ich finde solche Defizite bei mir nahezu regelmäßig beim Üben auch noch nach 30 Jahren Yoga. Und das ist auch ganz normal, denn ich werde älter und kämpfe wie alle Menschen mit körperlichem Verschleiß, den Wirkungen schlechter Gewohnheiten und den Übeln der Überflussgesellschaft. Lassen wir das mal so stehen. Welche Wirkungen zeitigen das richtige Üben?
Jeder, der mit Yoga beginnt, es übt oder praktiziert, [4. …nicht „macht“, Yoga machen ist Unsinn, denn machen kann man nur etwas in einer materieller Umgebung. Der Mensch aber sollte als organisch aufgefasst werden…], wird in Sachen Beweglichkeit an seine Grenzen stoßen. Dann wäre es notwendig, den ein oder anderen Körperradius durch Dehnungen zu vergrößern. Nun habe ich festgestellt, das Dehnungen, zum Beispiel Richtung Grätsche, viel leichter von Statten gehen, wenn man im Modus „Loslassen, Entspannen und Still-Werden“ an der Grenze seiner Beweglichkeit verharrt, anstatt mit Kraft über die ungeliebte Schwelle hinauszustreben. Die Grenze der Beweglichkeit ist dort, wo man gerade noch ohne Anstrengung hin gelangt. Das heißt auch, das man diese Grenze spürt, was bedeutet, das man sie schon mal leicht zu überschreiten versucht haben muss. In der Dunkelheit erkennt man ein festes Möbelstück dann, wenn man dagegen stößt und seinen Widerstand erfährt. Und dann vermag das Möbelstück, gegen das wir uns im Loslassen lehnen können, uns in der Dunkelheit Sicherheit zu geben. In Asana ermöglicht uns die Grenze, die wir erfahren, in Sicherheit eingebettet zu sein, wodurch Entspannung möglich wird und die Übung die zur Zeit mögliche Wirkung zeitigt. Verharrt man dicht an der Grenze, wird der Körper versuchen, dort für künftige Begebenheiten Raum zu schaffen. Er tut das auf seine ganz eigene Art und Weise, und kein Wissen kann uns dabei nützlich sein. Es können Wochen vergehen, und nichts geschieht. Und dann plötzlich macht der Körper einen Sprung, und siehe da, der Radius hat sich über Nacht erweitert. Und er machte das ohne die schmerzhaften Begleiterscheinungen, die sportliche Dehnungen gewöhnlich so an sich haben. Der Körper hat sozusagen durch die ständige Wiederholung der Anforderung – an der Grenze verharren – diese aufgenommen, die Bedingungen für Erweiterung geschaffen und dann wirksam umgesetzt.
Eine andere Art von Wirkung können Yoga-Übungen erzeugen, wenn der Körper oder seine Teile von unseeligen Verspannungen durchzogen wird. Meist macht sich dieses Beschwernis dann als schmerzhafte Äußerung in dem einen oder anderen Muskel bemerkbar, den wir dann als „verspannt“ bezeichnen. Das aber greift meist deutlich zu kurz. Im Grunde ist nicht der schmerzhafte Muskel verspannt, sondern das ganze System Mensch leistet sich Verspannung. Wer an seine erste klassische Thai-Massage zurückdenkt, wird wissen, was damit gemeint ist. Wo der Massage-Therapeut damals bei mir alles Verspannungen zu finden vermochte, werde ich niemals vergessen. Das zog sich von der Fußsohle bis zum Nacken hinauf und es wurde eine sehr lange Stunde. Im Grunde ist, wenn Schmerzen irgendwo auftreten, zum Beispiel Knie, das ganze System Mensch in Unordnung. Und entsprechend genügt es nicht, nur das Knie zu bearbeiten. Wichtig sind auch alle direkten und indirekten Mit- und Gegenspieler in diesem Körper, der genau genommen mehr einem Netzwerk von Funktionen ähnelt als einer Ansammlung von nicht austauschbaren Teilen. Kommt ein Mensch mit schmerzendem Knie in eine Übungsstunde, bleibt meist das Knie selbst unbearbeitet. Zunächst einmal müssen seine Nachbarn geöffnet, entspannt werden, und die betroffene Nachbarschaft kann sehr weit gehen in einem Netz. Weiterhin ist der Schmerz gepeinigte Mensch auch psychisch betroffen, sei es durch genervt, sei es ungeduldig, sei es verbittert sein. Und auch diese Verspannungen müssen gelöst werden, bevor lindernde Wirkungen zustande kommen können. Beim Thema Knie kam in der Vergangenheit oft heraus, das das Knie wie auch der Geist nur das Opfer waren eines Täters, der in der Wade, im Oberschenkel, in der Fußsohle oder gar in der Hüfte seine Platz hat. Irgendwann spürt eine Übung den Täter auf, und siehe da, nach seiner Beruhigung verschwanden dann auch die Schmerzen im Knie. Und natürlich kann die Ursache, die einen Täter erst gemacht hat, auch in der Psyche gelegen haben. Grundsätzlich gilt, Schmerzen hat nicht ein Teil, sondern immer der ganze Mensch. Und somit muss auch der ganze Mensch Ziel einer Behandlung sein, im genanten Fall als Beispiel mit Therapie-Übungsstunden.
Die Stufen 5-8 des Patanjali-Yoga-Systems beschäftigen sich mit Meditation. Und auch wenn die bisher beschriebenen „Turnstunden“ nur ganz kurz Meditationseinheiten ermöglichen – Ich bleibe zur Zeit insgesamt 2 Minuten in jeder Asana – braucht es für Meditation in Sinne von Dhyana schon etwas längere Übungszeiten. In der Regel werden für eine Sitzung in Meditation etwas zwischen 20 und 30 Minuten angesetzt, und empfohlen werden zumindest zwei Sitzungen pro Tag. Das ist auch sinnvoll, denn zum Beispiel in den Lotushaltungen, die für die Meditation sicher die Besten aller Sitzhaltungen sind, sollten die Beinseiten schon gleichmäßig belastet werden. Kreuzbeinige Sitzhaltungen zeigen immer eine einseitige Belastung. Ein Bein liegt unten, ein Bein oben, und das führt bei längerer einseitiger Belastung zu Fehlhaltungen im Becken- und Hüftbereich, im Oberschenkel und im Knie bis zum Fuß hinunter. Irgendwann dann ist entspanntes Sitzen so nicht mehr möglich. Jede Sitzhaltung ist eine Asana, und zu deren Einrichtung, Haltung und Vorbedingungen gelten daher auch die bereits vorgestellten Aussagen. Und auch hier ist es oftmals notwendig, längere Zeit für der Ausformung der Sitzhaltung zu investieren. Die Stille der Gedanken im Geist ist nur möglich in einem entspannten Körper und in Begleitung eines ruhig und mühelos fließenden Atems. Die Stille des Geistes führt ohne unser Zutun zu Samadhi, der Versenkung. Das einmal zu erreichen ist der erste Meilenstein auf dem Weg der Meditation. Der zweite Meilenstein finden wir in der Aussage, Samadhi öfters zu erreichen oder sogar regelmäßig zu erfahren. Hier aber gehe ich jetzt nicht mehr weiter, denn ich sollte nur von Dingen schreiben, die ich auch durch bestätigte Erfahrung belegen und somit bezeugen kann. Weiter bin ich bisher nicht vorgedrungen.
Soweit zunächst einmal eine Beschreibung meiner Ansichten über die Praxis des Yoga, so wie ich es selbst praktiziere und auch unterrichte. Das die Wirkungen des Yoga wie gelesen nur erlebt, nicht aber erlernt werden kann, ist die Maxime der Weitergabe der Techniken immer Hilfe zur Selbsthilfe, oder anders formuliert ist es das Ziel der Weitergabe, zu regelmäßiger selbstständiger Praxis zu ermuntern. Und regelmäßig heißt täglich, und selbstständig heißt „allein für sich zu Hause“. Die Arbeit in der Gruppe und/oder mit einem Lehrer ist lediglich eine zusätzliche Ergänzung, die zu neuen Ideen und neuer Motivation beitragen kann. Allein zu Hause zu üben, ohne Anleitung, ohne Kritik, ohne fachliche Betreuung, ohne Lehrer, Guru oder Meister, bedarf in meinen Augen aber einer weltanschaulichen, philosophischen und ontologisch geschulten Basis, mit der der Übende aus der oftmals Schicksal-verliebten, Regel-hörigen, Traditions-verstrickten, oder mit anderen Worten gesagt dogmatisch verhärteten Sichtweise über Yoga und Körperarbeit auszusteigen vermag. Yoga als Praxis bedarf keiner Symbole, keiner besonderen Lebensweise, keinerlei Lifestil und auch keiner besonderen Atmosphäre, und das besonders dann nicht, wenn man allein zu Hause für sich übt. Es genügt eine rutschfeste Matte, ein ruhiges Umfeld und etwas Zeit. Mehr nicht!
Die Yogaschriften sind sehr alt, mindestens 1000 Jahre, und niemand weiß wirklich genau, wer dort alles geschrieben hat und welche Intention die Autoren verfolgt haben. Eindeutig und klar sind die Hintergründe wirklich nicht, und viele Beschreibungen und Verfahren muten uns heute etwas archaisch an. Besonders der in neueren Büchern stets rot bezeichnete Abschnitt der Pradipika zum Beispiel spricht dafür mehr als deutlich. Ich bin der Ansicht, das man die Zeit der Verfasser berücksichtigen muss, in der die Werke entstanden. Die Religion und Kultur spielen eine sehr große Rolle, die Vorstellungen über Körper, Krankheit und Auswirkungen des Todes (Wiedergeburt, Nirvana, Fegefeuer, Paradies) spielen Rollen, und viele möglich andere, aber weniger prägnante Vorstellungen sollten ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Dann ist Yoga und seine Übungen für Männer als Übende ausgelegt. Frauen spielten in den Kulturen der damaligen Zeit keine oder vielleicht nur eine sehr kleine Rolle, besonders in Indien. Summa sumarum erfolgt daraus die Schlussfolgerung, das die besagten Schriften heute nach und mit den bestehenden Kulturvoraussetzungen überarbeitet und neu ausgelegt werden müssen. Eine Arbeit, von der sich viele moderne Autoren gerne drücken. Yoga ist nach den Beschreibungen der alten Schriften aus heutiger Sicht mit vielen religiösen und spektakulären Facetten ausgelegt, ist voller Übertreibungen und ausgeschmückten Geschichten. Da finden sich oftmals Anweisungen, die nur geübte Fakire ausführen können, da wirken Wunderheiler und übermächtige Gurus, da werden übermenschliche Wundertaten wie Selbstverständlichkeiten gesehen und dem lesenden Publikum angedient. Nun findet man Solcherlei in allen Religionen und Kulturen, aber gerade Indien ist bekannt dafür, in Erzählungen gerne maßlos zu übertreiben. Wer sich weiterhin einmal die Krankheiten angesehen hat, die heute noch in auf klassische Schriften sich beziehenden Yogabüchern ausgewiesen werden, wird feststellen, das viele davon heute in der Volksgesundheit nahezu keine Rolle mehr spielen. Und wirklich wichtige Krankheiten heute, wie Übergewicht, Diabetis, Bluthochdruck, Krebs, MS, Alergien, Psychisch-Ausgebrannt-Sein (Burnout), fehlen dafür vollkommen. Nur orthopädische Leiden wie Rückenschmerzen, verkürzte oder verspannte Muskelpartien und die üblichen körperlichen Überlastungsstörungen durch zu viel und zu harte Arbeit ziehen sich durch von der Antike bis heute in nahezu allen Traditionen.
Was Yoga und eine mögliche Auslegung betrifft, sind aber nicht alle Inhalte der klassischen Schriften wo zuvor ausgewiesen für die Moderne nicht verwendbar. Interessant sind aber dann nicht die vielen Details, sondern viel mehr die Prinzipien, die dort beschrieben werden. So schreibt die Pradipika zum Beispiel, das ein entspannter Körper, ein sanfter natürlicher Atem und die Stille des Geistes eine hervorragende Ausgangslage bieten, um heilsame Veränderungen im Körper-Geist-(Seele)-System Mensch zu bewirken. Und das stimmt exakt und ist auf den Punkt getroffen. Ich will in den nachfolgenden Zeilen einmal versuchen, etwas näher auf solche Prinzipien einzugehen.
- Zunächst einmal muss festgehalten werden, das ich als Mensch keinen Körper habe, sondern einer bin. Dann, wenn wir diese Beobachtung wahrnehmen, haben wir auch keine Schmerzen, keine Krankheiten, sondern wir sind diese Schmerzen und verursachen damit die Krankheit selbst. Unfälle, Vergiftungen und Gewaltanwendungen, die von außen an uns herangetragen werden, müssen dabei logischerweise unberücksichtigt bleiben.
- Dann leben und denken wir ja sehr überzeugt in einer Ursache-Wirkung-Erzählung. Selten aber wird dabei berücksichtigt, das eine Wirkung auch zwei oder mehr Ursachen haben kann, das eine Ursache auch viele Wirkung haben kann, und das auch viele Ursachen für viele Wirkungen am Anfang stehen können. So eindeutig und klar, wie so manche Beschreibung das sieht, ist das Prinzip Kausalität daher leider nicht zu verstehen. Und allein schon die Tatsache, das es hoch entwickelte Kulturen gibt (China, Taoismus, Konfuzianismus), die vollkommen auf dieses Prinzip verzichten und trotzdem sich sehr hoch entwickeln konnten und das auch heute noch fortgesetzt tun, spricht dafür, diesem Prinzip nicht den Stellenwert einzuräumen, der ihm in der Philosophie europäischer Prägung zugestanden wird. Überhaupt hält die Suche nach den Ursachen eines Motivs selten einer Überprüfung auf Vollzähligkeit stand. Sehr oft wird in den Wissenschaften, selbst in der Medizin heutiger Prägung, das erste sich bietende Motiv als Ursache deklariert, angenommen und dann einer Behandlung unterzogen. Die oft zu hörenden Geschichten von Menschen, die monate- und jahrelang von Arzt zu Arzt, von Therapie zu Therapie irren, ohne wirkliche Hilfe zu bekommen, sprechen hier eine eindeutige Sprache. Und die vielen Irrtümer der Wissenschaften, von der Erde als Scheibe bis zur Ignoranz der Gefährlichkeit der Radioaktivität, die viele dieser auch heute noch nicht zuschreiben, gibt es Unmengen an Beispielen.
- Weiterhin leben wir in einer Kultur, die Moralvorstellungen in der Form von Narrativen als ihre Basis betrachtet, die weniger die vielfältigen Möglichkeiten eines glücklichen Lebens in Sinne hat, sondern sich vielmehr ein Leben angefüllt mit Tugenden, Pflichten und Passionen vorstellt und dieses als grundlegend voraussetzt. Nur sind Passionen selten mit einem guten Leben vereinbar, Pflichten selten mit Erfüllung bedacht und Tugenden selten freudvoll. Wollen wir wirklich nur noch in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft leben, nur noch das Beste aus allem machen, oder ist nicht immer auch schon die Möglichkeit gegeben, einfach zufrieden zu sein mit dem, was ist.
- Dazu kommt, das sehr viele Weltsichten und Religionen Europas und Indiens darauf ausgerichtet sind, einen möglichst guten Start ins Jenseits sprich Paradies zu erwirtschaften oder eine bessere Ausgangsbasis für die wie immer auch ausgestaltete Wiedergeburt zu erlangen. Das verlangt Opfer im hier und jetzt und auch das kann selten als frei und freudvoll angesehen werden. Das geht von einem Verzicht auf jegliche sinnliche Erfüllung bis zu einem zwanghaft aufgerichtetem Leben in Einsamkeit (Kloster) oder sogar unter Martyrien (wie Asketen im Hinduismus). Wer aber kennt die Antwort auf die Frage: Was passiert nach dem Ableben wirklich? Wiedergeburt, Paradies oder Hölle, die Unterwelt, Nirvana, Himmlische Freuden oder Höchstes Gericht? Warum leben wir nicht einfach unser Leben und lassen uns überraschen? Zu einfach?
- Dann leben und denken wir seit mehr als 2000 Jahren einen Dualismus, der sich definiert als eine absolute Vorgabe der Widerspruchsfreiheit innerhalb einer Aussage. Das heißt, es gibt nur noch ein Entweder-Oder, und alles wird radikal reduziert auf zwei Möglichkeiten. Dabei übersehen werden meist drei weitere Möglichkeiten einer Entscheidung bei einer Wahl zwischen zweier Motiven: Da gibt es doch auch das Weder-Noch, da gibt es ein Sowohl-Als-Auch und es bieten sich sogar noch zwei weitere Lösungen an, die da heißen, Offenheit oder „Ich entscheide mich jetzt nicht…“ und die Skepsis, die da sagt „Die Frage ist falsch gestellt. Sie ist für mich daher so nicht relevant“. Und warum sollte es immer nur zwei Möglichkeiten geben. Vielleicht gibt es drei, vier oder unendlich viele Varianten. Warum hat man eigentlich mal Brainstorming erfunden? Damit alles auf Zwei reduziert bleibt, zwischen denen man sich entscheiden kann? Eigentlich Unsinn…
In meiner Vorstellung angesichts einer Absicht, Problemstellung, Entscheidung oder Zielvorgabe, die es zu erreichen, zu lösen oder zu entscheiden gilt, sollten alle Möglichkeiten erwogen oder abgeschätzt werden. Meist bleiben aus der Vielzahl dann sowieso nur wenige gängige und heilsam dienende Varianten bestehen. Selten sind es mal gerade Zwei oder gar nur eine Einzige. Oftmals werden dabei schnell Varianten in Betracht gezogen, die sich bereits bewährt haben in der eigenen Geschichte, die aus Erzählungen anderer bekannt geworden sind oder die eine große Sicherheit versprechen, um dann schnell darauf zu drängen, umgesetzt zu werden. Sie beginnen häufig mit „Man“. Bemerke ich diese Motive, reagiere ich vorsichtig. Was einmal oder mehrmals geklappt hat, kann und muss nicht beim nächsten Mal ebenfalls gelingen. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, die aber oft in der Hetze der Zeit vernachlässigt wird. Gerade in der Körperarbeit ist das häufig zu beobachten. Der Satz von 60 Asanas hat sich in 1000 Jahren immer wieder bewährt. Wir sollten ihn nicht ändern, und die Anweisungen des/der Lehrer unbedingt folgen, denn er/sie unterrichtet aus einer sehr alte Tradition. Leider kennen alte, sehr alte Traditionen keinen Acht-Stunden-Büro-Job mit Bildschirm und Tastatur. Auch gibt es in den alten Traditionen kein ADHS, keine Depressionen, kein Borderline-Syndrom und auch keinen Burnout. Auch waren Bewegungsmangel, Übergewicht und andere Hoch-Zivilisationskrankheiten in den alten Zeiten seltener zu beobachten. Dafür gab es andere Erschwernisse, die heute gar fast keine Rolle mehr spielen. Warum sollten daher die guten alten Yogaübungen dieser Zeit also gegen unsere schlechten Gewohnheiten helfen. Sicherlich gibt es im weit fortgeschrittenen Yoga-Milieu, besonders in den Meditationsanleitungen, gewisse Übereinstimmungen in allen Zeiten. Aber die körperlichen Voraussetzungen dazu sind auf jeden Fall verschieden. Ich plädiere daher auf jeden Fall für ein ganz besonders genaues Hinschauen, welche Yamas, Niyamas, Asanas, Pranayamas und Meditationen den neuen Anforderungen noch gerecht werden. Selten muss ja zum Beispiel bei Asana und Pranayama die ganze Übung verändert werden, es sind mehr die Intensität der Übung, die Intensionen und die kurzzeitigen Zielvorstellungen, die an die Moderne angepasst werden sollten. Die alten Yamas und Niyamas im besonderen berühren die philosophischen, ontologischen und gesellschaftlichen Zustände und Erfordernisse der heutigen Zeit in Mitteleuropa nur wenig. Dazu sind die Formulierungen für die Komplexität unserer Zivilisation zu oberflächlich und nicht differenziert genug.
Im Grunde kann und muss heute für das Üben von Yoga eine andere Grundausstattung an Vorbedingungen präsentiert werden. Das beginnt damit, das Yoga für ein Leben konzipiert werden sollte, das heute, hier und jetzt und in einer Lebenserwartungs-nahen Zukunft geschehen soll. Für eine Wiedergeburt vorzuarbeiten oder vorgegebenen Regeln zu folgen, die ein paradiesisches Weiterleben nach dem Tod ermöglichen könnten, wird unserer heutigen Erwartung ans Yoga nicht mehr oder nur noch selten gerecht. Fünf Erscheinungsbilder für Yoga können heute beobachtet werden:
- Da gibt es Yoga als Freude an Sport und Bewegung.
- Dann Yoga als Vorsorgepraxis bezüglich der körperlichen Gesundheit.
- Dann wird Yoga als Therapieform verwendet, um Zivilationsbelastungen zu kurieren.
- Dann gibt es Yoga als eine Steigerungsform im Selbstgestaltungsprozess. Das gilt sowohl für körperliche (z.B. Beweglichkeit) als auch mentale (z.B. Konzentration) und meditative (z.B. Bewusstseinserweiterung) Formen.
- Weiterhin kann Yoga als spirituelles Narrativ (Wir Yogi(ni)s…) praktiziert werden.
Alle fünf Formen besitzen ihren Charme und gelten als sehr beliebt. Und sie haben ihre Berechtigungen. Trotzdem können eigentlich nur „die Freude an Bewegung“ und eine „Vorsorgepraxis“ den vollen Yoga-Ansprüchen genügen. Die Therapieformen benötigen Erweiterungen, zu nennen sind da bevorzugt Ayurveda, Thai-Massage und natürlich ärztliche Begleitung [1. Das ist schon aus rechtlicher Sicht unbedingt erforderlich.]. Als Selbstgestaltung-Praxis müsste geklärt werden, wo denn die Zielvorstellung derselben eigentlich liegen sollte. Wenn man sich in der Yoga-Literatur umschaut, gibt es dafür eigentlich nur Warnungen. Große Kundalini-Erfahrungen zum Beispiel gehen oftmals mit langwierigen körperlichen Krankheitsbildern einher, kleinere Energie-Erfahrungen lassen die Fragen offen, welcher Nutzen daraus abgeleitet werden kann. Nur langjährige Erfahrungen und intensive Übungspraxis könnten eine solide Grundlage dafür schaffen. Sicherheitshalber aber keine Energie-Erfahrungen mehr zu machen aber werden dem Yoga einfach auch nicht gerecht, da diese gebraucht würden, um seine Gestaltungsabsicht kontrollieren und leiten zu können. Die in den Schriften beschriebene yogische Meditationspraxis dann ist eine sehr eingeschränkte Form und lässt viele Motive unangesprochen. Hier sind zum Beispiel Zen und und die Zinn‘schen Stressreduktionsmethoden deutlich weiter. Und die Identifizierung mit der Gruppe, die das eigentliche Motiv der häufigen Identifikation mit der Yoga-Lehre ist, ist auch nur ein Narrativ unter vielen anderen. Nicht-Identifikation wäre eher statt dessen angesagt: „Ich lebe in Unabhängigkeit, Unbedingtheit und Freiheit“. Es sind ja gerade die Identifikationen mit irgendwelchen Vorstellungen, die das moderne Leben so belastend machen. Als Fazit bleiben nur „Freude an Bewegung“ und die Vorsorge als Motive übrig, die in der Breite der Gesellschaft praktiziert werden und als fördernd angesehen werden könnten. Seien wir ehrlich: Wer hat heute noch Zeit und Muße, um täglich zwei Stunden Yoga und Meditation über einen langen, in Jahren auszudrückenden Zeitraum, üben zu können. Und das ist sozusagen vom Aufwand her das Minimum, das erbracht werden müsste, um zumindest eine solide Grunderfahrungen des Yoga vermitteln zu können.
Kommen wir jetzt, nachdem der Status „heute“ ausreichend dargelegt wurde, zu den Voraussetzungen im Denken und in der Lebensgestaltung, die Yoga als fördernd ausstatten können.
Yoga, ob als Freude an Bewegung oder als Technik auf ein Ziel ausgerichtet ist immer Arbeit an sich selbst. Es kann nicht gemacht werden, was nur den körperlichen Aspekt einschließen würde, es kann auch nicht mal so als Ausgleich für irgendetwas Belastendes angesehen werden, weil das den ganzheitlichen Aspekt, der immer da ist, nicht einschließen würde, noch kann es mal so einfach mitgenommen werden, weil zum Beispiel meine Freunde das auch machen. Yoga ist Arbeit an sich selbst. Man kann nicht ins Wasser springen, ohne nass zu werden. Wenn ich an mir selbst arbeite, verändert sich das Sein, unmerklich vielleicht, aber nachhaltig. Und ohne Erfahrung oder fachliche Anleitung weiß der Übende nicht, was da so alles betroffen sein wird. Yoga arbeitet, kann somit ein Lebensgefüge verändern. Ob das Ergebnis dann als gewünscht betrachtet oder eher betroffen machend erlebt wird, ist ungewiss. Wohlgemerkt, ich spreche von einer vollen Yoga-Praxis, das heißt täglich zwei Stunden als Minimum in einem in Jahren zu rechnenden Zeitraum.
Yoga-Übungen, ob Asana, Pranayama oder Meditation, müssen, um wirksam sein zu können, angemessen ausgeführt werden. Zuviel oder zu wenig Intension, ohne Konzentration ausgeführt, ohne Maß oder mit zu viel Ehrgeiz ausgeführt wirken sie gar nicht oder gehen sogar in eine unerwünschte Richtung, sprich: So können sie sogar Schaden anrichten! Yoga arbeitet körperlich immer an der Grenze zwischen der Wahrnehmung von „da tut sich was“ und beginnendem Schmerz. In diesem schmalen Fenster erscheinen energetische Wahrnehmungen, sind leichte Anspannungen und auch Entspannungen wirksam möglich. Innerhalb dieser Begrenzungen zu bleiben erfordert einen maßvollen Einsatz von Willen, erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Vertrauen in die eigene Beständigkeit. Die Arbeit mit dem Atem, Pranayama, erfordert zusätzlich die Gewissheit, das der Atem nicht falsch ist oder Veränderungen bedarf, um gut zu sein, sondern das man sich nur weitere Möglichkeit erschließt, die der Atem gehen kann und die ihn dann zu einem vielseitigerem Wirken in die Lage versetzen. Bei den Meditationsübungen wird der Übende schrittweise an die Wahrnehmung der Wirklichkeit herangeführt. Das ist nicht immer nur wunderschön, sondern geht tief in die eigene Konzeptionierung hinein und konfrontiert den Übenden mit seinem wirklichen Sein. Er wird Gedanken, Wünsche und Triebe in sich entdecken, die ihm bisher nicht bewusst geworden sind und die oftmals mit den gesellschaftlichen Normen im Widerstreit stehen. Die Wanderung durch „das dunkle Tal der Seele“, wie Eckhardt das nannte, erst führt mit der Meditation dann ins heller werdende Licht. Darauf sollte man sich gefasst machen und das sollte man auch durchstehen wollen, bevor man auf die große Reise geht.
Yoga-Praxis hat nichts mit Fitness zu tun, nichts mit Sport oder Akrobatik. Auch muss für Yoga nicht unbedingt eine große Flexibilität vorausgesetzt werden. Im Gegenteil, je weniger Raum der Körper eines Übenden zur Verfügung stellt, desto eher wird er in den schmalen Korridor zwischen Wahrnehmung und Schmerz gelangen. Das Problem allerdings, das diese Aussage beinhaltet, ist, das die alt-bekannten und auch wirkungsvollen Yoga-Haltungen schon im Vorfeld eine recht hohe Flexibilität voraussetzen. Ist diese nicht begeben, müssen diese großen Übungen zugunsten von Vorübungen hinten angestellt werden. Grundsätzlich gilt, das die Ausgangshaltungen einer Yogaübungen leicht und bequem eingenommen werden müssen. Das gilt für den Meditationssitz, das Sitzen im Pranayama als auch für die Asanas. Beginnt die Übung bereits mit einer Anspannung, ist der Korridor der Wirksamkeit verschoben und der Übende kämpft dann nur noch gegen seinen Ehrgeiz. Aus der bequemen Ausgangshaltung beginnt das Vortasten in den beschriebenen Korridor, in dem letztlich verharrt wird. Das gilt für alle Haltungen gleichermaßen. Bei Übungen, die wie im Handstand natürlich eine Anspannung getragen werden muss, wird diese auf die notwendigen Regionen begrenzt, beim Handstand zum Beispiel sind das die haltenden Arme und Schultern. Woran aber erkennt der Übende bei anstrengenden Übungen, das die Haltung korrekt eingenommen wurde? Bei wenig erfahrenen Übungsteilnehmern wird diese Aufgabe vom Lehrer übernommen. Bei geübten Teilnehmern, die auch schon allein praktizieren, erfüllt diese Aufgabe Maha-Bandha. In allen Übungen ist die Wahrnehmung dieses Bandes, mehr oder weniger deutlich, möglich. Wie dieses Band gesetzt wird und wie es wirkt, übersteigt die Thematik dieses Artikels. Es wird dazu bald einen eigenen Artikel geben.
Zusammengefasst kann über Yoga gesagt werden, das wir es als eine Methode zur Arbeit am eigenen Lebendig-Sein ansehen sollten. Es hat weder religiöse noch esoterische oder mystische Hintergründe, schreibt weder eine spezielle Art sich zu kleiden, zu kommunizieren noch zu essen vor, braucht weder Hingabe an einen Guru noch Anbetung irgendwelcher Götter und kann somit von jedem Menschen praktiziert werden. Was er dazu braucht ist lediglich etwas Aufmerksamkeit, ein wenig guten Willen, viel Geduld und etwas Zeit zum Üben. Der notwendige Zeitaufwand beginnt bei etwa 20 Minuten täglich und steigert sich nach und nach auf eine Stunde. Unter Einbindung von Pranayama und Meditation erweitert sich das dann auf etwa zwei Stunden täglich. Weniger geht meiner Ansicht nach für eine volle Praxis, was ich den Yoga-Weg nenne, nicht. Dieser Weg kann nicht gültig für Alle beschrieben werden, der er erfordert individuelle Ausführungen und Intensionen, die nur mit dem Wort Selbsterfahrung ausreichend beschrieben sein können. Wer den Weg gehen will, muss bereit sein, Erfahrungen selbst, an eigenem Leib und Wesen, zu machen.