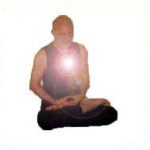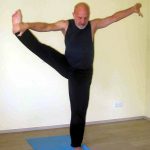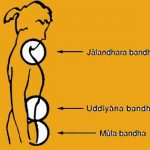Wenn wir uns die Yogasutras des Patanjali vergegenwärtigen und nach diesen unsere Übungen gestalten, kommen wir um eine Definition unserer Begrifflichkeiten nicht herum. Yoga beschäftigt sich nach Patanjali mit dem „Zur-Ruhe-kommen“ der seelisch-geistigen Vorgänge und darauf aufbauend mit dem Ziel, zum Wesenskern des Selbst vorzudringen. Andere Autoren belegen diese Zeile der Sutras mit anderen Worten, wobei Bewusstsein, Denksubstanz oder auch alle Aktivitäten des Geistes genannt sein können. Was ist aber wesentlich und praktisch mit diesem Satz gemeint?
Exkurs (Körper, Geist und Seele): In unserer Kultur unterscheiden wir als Lebensträger zwischen den Begriffen Körper, Geist und Seele, wobei zwischen Körper und Geist die Sinne als Vermittler gedacht werden, die beiden Anteilen zugeordnet werden könnten. Weiterhin wird die Fähigkeit des Denkens oft sehr eindeutig dem Geist zugeordnet, wobei die Wahrnehmungen, die sich im Denken ausdrücken, eindeutig den Sinnen und daher auch dem Körper zugeordnet sein könnten. Zweifelsfrei sind Schlussfolgerungen und Erinnerung der Geistsphäre zugeordnet, wobei allerdings die Intuition sowohl dem Geist auch der Seele angehören könnte, je nachdem, mit welcher Definition dieser Wahrnehmungs- und Erkenntniseigenschaft versehen wird. Gedanken können aus der Erinnerung (Geist), der Wahrnehmung (vom Körper zum Geist) oder aus intuitiver Erkenntnis (von der Seele zum Geist) stammen. Nicht angesprochen wurde bisher die menschliche Fähigkeit zu träumen, die zwar dem Bewusstsein bzw. dem Unwort „Unbewussten“ zugeordnet wird, aber auch ein seelisches Phänomen sein könnte. Und ein wie auch immer gestalteter Gott – als Person, als Seins-Grund oder Herrscher -samt seinen Propheten und Stellvertreter sollten dann auch noch genannt werden. Alles in allem ist das eine sehr unübersichtliche Lage, aus der heraus argumentiert werden kann. So erklären sich auch die vielfältigen Systeme und Auslegungen, Philosophien und Psychologien, Weltanschauungen und Religionen, mit denen wir in der Auseinandersetzung des Begreifens und Erkennens zu kämpfen gewohnt sind.
Eine Antwort darauf werde natürlich auch ich schuldig bleiben. Aber ich möchte einige Überlegungen beitragen, die mir geholfen haben, ein für mich praktikables System zu entwickeln. Da es meine Überzeugung ist, das jeder Mensch letztlich sein eigenes System entwickeln muss, um Sinn zu finden, sollte dieses vom Leser auch nicht einfach nur übernommen, abgelehnt oder zerredet werden, sondern sollte lediglich als Beispiel dienen und erklären, warum und wie ich als Yogalehrer etwas unterrichte. Weiterhin ist dieses System auch nicht festgefügt, sondern gestaltet sich nach jeder Erfahrung, nach jedem Buch und jedem Gespräch neu und ist somit ein Bild des Jetzt (2012), das mit jeder Minute nach dessen Niederlegung weiter verschwimmt.
In meinem Denken sind Körper, Geist und Seele nicht getrennt voneinander, sondern stellen sich gleichberechtigt und ergänzt durch Historie und Konvention (Übereinkunft innerhalb der sich angeschlossenen Kultur) wie eine heterogene Gesamtheit (Dispositiv) dar. Dabei sind vielfältige Verknüpfungen, Abhängigkeiten und Zusammenhänge denkbar, die sowohl direkt (Bild: Verbindung), begleitend (Bild: Magnet, der ein Stück Metall mit- oder anzieht) oder auch indirekt (Bild: Ökosystem) ausgestaltet sein können. In meiner Erfahrung ist in diesem Pentamer (Fünfgliedrigkeit) die Konvention (Verhaltensnorm) der größte formende Anteil, direkt gefolgt von der Historie (persönlichen Geschichte). Körper, Geist und Seele sind angesichts der Wucht geschichtlicher und kultureller Prägungen heute nahezu in den Hintergrund gerückt. Der Mensch kann in einem schönen oder hässlichen, kranken oder gesunden Körper glücklich und zufrieden sein und kann selbiges mit viel, weniger oder keiner Intelligenz erreichen. Viel schwieriger ist das Leben mit einer nicht konformen Vergangenheit (zB. vorbestraft sein), in einem feindlichen Umfeld (zB. als Mitglied einer religiösen oder politischen Minderheit) oder als Zugehöriger eines Volkes, einer Klasse oder Rasse. Die Seele bleibt, da sind sich alle Religionen und Weltanschauungen ausnahmsweise einig, von solchen Motiven eher unberührt.
Wenn also ein Zur-Ruhe-kommen geeignet sein könnte, etwas zum Bessern zu wenden, so muss dieses in Kultur und Vergangenheit und der Aufarbeitung derselben gesucht werden. Das sich diese Motive wie alles Wahrnehmen, Erinnern und Reflektieren letztlich im Geiste ausformt und kenntlich macht, ist lediglich ein sekundäres Phänomen.
Nehmen wir zunächst einmal die einfache Sachlage, die mit der Geburt in provinziellem oder städtischem Kulturkreis beginnt. Die daraus folgenden Erziehungsmotive sind unterschiedlicher als sie gar nicht sein können. Auf der provinziellen Seite erhält man Stütze und Geborgenheit in einer Gemeinschaft, die allerdings auch nur einen begrenzten Bewegungsradius zulässt. Anders in der Stadt, wo man sich im Rahmen der Gesetze durchaus umfangreich bewegen kann, allerdings erfährt man hier wenig Stütze und noch weniger Geborgenheit. Ein ähnliches, jedoch kleineres Gefüge findet sich in mancher Familie wieder.
Ein weiterer schwerwiegender Punkt ist die Abnabelung von Eltern und Familienangehörigen, die maßgeblich zur Erziehung beigetragen haben. Weil dieser Prozess selten gelingt, hatten alte Kultur- und Naturvölker die Initiation eingeführt, die einen neuen Namen, einen neuen Status und einen Neuanfang ohne die Last der Vergangenheit ermöglichte. Auch spirituelle Übungswege, die auch heute noch bis zu einem Klostereintritt gestaltet sein können, arbeiten mit diesem Motiv.
Dann konservieren wir unsere und unserer Mitmenschen Vergangenheit in Erinnerungen und Aufzeichnungen, die einen einmal begangenen Fehltritt oder eine Unsicherheit bis zum Sterbelager unvergessen machen. Einen Saulus, der als Verbrecher zu Paulus werden und eine Weltreligion gründen konnte, schafft einen Neuanfang heute nur noch hinter Klostermauern oder in der Fremdenlegion. Ein veröffentlichtes Buch, das Spielen in einem Film, die Teilnahme an Diskussionen oder Demonstrationen kann heute ein freies unbeschwertes Leben auslöschen. Sogar ein noch als Kind zur Entflammung gebrachter Weihnachtsbaum kann und wird heute als Waffe gegen einen politischen Gegner eingesetzt. Und wer sich als Teenie heute in Facebook leichtsinnig outet, bekommt ebenfalls einen unwiederbringlichen Fleck auf der ursprünglich weißen Weste. Die Vergangenheit hält uns fest im Griff.
Ein weiterer unbarmherziger Einfluss auf unser Leben hat die uns auferlegte Sprache und deren Zugehörigkeit zu einer Kultur. Das semantische Gefüge mancher Sprache lässt nicht alle Überlegungen und Gedankengänge zu. Sprache gehört zur Konvention, die eine Übereinkunft darstellt, die in aller Regel von der Mehrheit und den Mächtigen eines Volkes bestimmt wird.
Exkurs (Übersetzungen aus dem Englischen): In vielen Diskusionen, die sich um die Sinnstiftung eines Lebens drehen, wird zwangsläufig auch das Leib-Seele-Problem aufleuchten, das mittlerweile schon 2500 Jahre Philosophiegeschichte beschäftigt und zum Teil widersinnige Ergebnisse zeitigt. Dabei geht es oft nahe ausschließlich um sprachtechnische Schwierigkeiten wie zB die Übersetzung des englischen Begriff „mind“, der im Deutschen sowohl als „Geist“ als auch als „Geist-Seele“ übersetzt werden kann, wobei oft mit Geist das Denken und mit Geist-Seele das Bewusstsein angesprochen wird. Die alternativen Begriffe „awareness“ und „consciousness“ für Bewusstsein können aber auch als Wahrnehmung oder Besinnung verstanden werden und bieten daher keine Lösung an. Im Großen und Ganzen sind daher selbst die Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche schon mit Schwierigkeiten behaftet. Wie viel schwieriger gestaltet sich eine Übersetzung aus einer vergangenen Kultur und Sprache, wie sie das Sanskrit darstellt.
Nahezu jede Kultur beinhaltet Vorschriften und Regeln, die nahezu alle Regungen des Geistes und des Gestimmtseins reglementieren. Das geht von der Methode des Trauerns bis hin zur friedenstiftenden Auseinandersetzung, wobei nichts der persönlichen Vorliebe oder gar dem Zufall überlassen bleibt.
In diese Gefüge hineingeboren finden wir uns alle irgendwann mit der Aufgabe konfrontiert, ein selbstbestimmtes Leben führen zu wollen oder gar zu müssen. Und bei dieser Aufgabe hilft uns ein System wie Yoga, in dem es uns benötigte Werkzeuge in die Hand gibt. Diese bieten neben der Aufarbeitung körperlicher und energetischer Vernachlässigung einen Erkenntnisweg, der uns mit der Meditation bis zum Wesenskern des Selbst vordringen lässt und damit die Vergangenheit und die Konventionen jeglicher Art in einem neuen Licht erscheinen lassen.
Das Leib-(Geist)Seele-Problem ist aus einer Yoga-Sichtweise nicht das vorherrschende Problem des modernen Menschen, sondern wichtiger erscheinen mir die Be- und Verarbeitung der Erinnerung und die Arbeit an Konventionen. Damit werden sich zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Blog weitere Artikel ausführlicher beschäftigen müssen.